Loryndal
Der Kontinent Loryndal - Eine Übersicht
Karte des Kontinents
Loryndal ist ein Kontinent der Gegensätze: Von den eisigen Frostlanden im hohen Norden bis zu den glutheißen Sandwüsten im Südosten spannt sich ein breites Spektrum an Landschaften, Kulturen und politischen Systemen. Die mächtigen Bergketten, die fruchtbaren Ebenen der Herzlande, die mystischen Wälder und die gefährlichen Ruinen längst vergessener Hochkulturen prägen eine Welt, in der imperiale Ambitionen, göttliche Glaubensvorstellungen und der Kampf ums tägliche Überleben ein dichtes Geflecht menschlicher, elfischer, zwergischer und orkischer Schicksale weben.
Im hohen Norden finden sich die stolzen Zwergenreiche, tief unter Fels und Eis verborgen, während die zäh gewordenen Barbarenstämme sich zu einem frostigen Bund zusammenschlossen und nun gegen Untote und Hungersnöte gleichermaßen kämpfen. Weiter südlich, im Herzen des Kontinents, erstrecken sich Flussläufe, Wälder und weite Felder, in denen junge, aufstrebende Reiche neben alten Monarchien gedeihen, Handel blüht und Intrigen zur Tagesordnung gehören. Noch weiter südlich lockt eine Freistadt mit Neutralität und Reichtum, während ein furchtloses Protektorat von Kriegern die sprichwörtliche Unbesiegbarkeit verkörpert.
Im Südosten lauert die Wüste Qualhazirs, durch die Sklavenjäger streifen und exotische Handelsgüter gehandelt werden. Im Westen der Herzlande erhebt sich ein junges Reich der Möglichkeiten, in denen Abenteurer und Ausgestoßene neue Chancen finden, während am Rand der Zivilisation die zerfallenen Ruinen von Prythania von einstiger Größe und einem unergründlichen Untergang künden.
Rings um den Kontinent liegen verstreute Inseln mit ihren ganz eigenen Welten: ein Exil für Orks, denen der Boden des Festlands genommen wurde; ein erbarmungsloses Theokratieregime, das den Faden des Schicksals in strenger Frauenherrschaft spinnt; ein isoliertes Elfenreich, das in perfekter Harmonie mit der Natur lebt, aber alle Fremden mit kalter Arroganz abweist; und eine freie Stadt, in der Gold die einzige Gesetzmäßigkeit darstellt. Sogar ein Protektorat aus Elitekriegern hat sich auf seiner eigenen Insel festgesetzt, unangreifbar und von allen gefürchtet.
Diese Vielfalt an Staaten, Kulturen und Regionen ist es, die Loryndal zu einer Welt voller Abenteuer, Geheimnisse und Wandel macht. Jeder, der über die Grenzen seines Heimatlandes hinausreist, sei es als Händler, Diplomat, Söldner oder Forscher, entdeckt eine neue Facette dieses Kontinents. Zwischen Gletschern und Wäldern, zwischen Basar und Festung, zwischen glühenden Wüsten und verborgenen Untergrundreichen warten Geschichten, Gefahren, Bündnisse und Konflikte.
Das nördliche Frostland
Durvalkar – Das Zwergenkönigreich
Tief unter den eisigen Frostlanden Loryndals verborgen, erstreckt sich Durvalkar, das Reich der Zwerge (Die Städte Durvalkars). Wo andere Völker unter freiem Himmel leben, haben die Zwerge ihren Lebensraum seit Jahrhunderten in die Tiefe verlegt. Dunkle Stollen, gewaltige Kammern, leuchtende Grotten und schimmernde Erzadern durchziehen die Felswelt Durvalkars wie ein pulsierendes Geflecht von Adern, in denen das Blut des Reiches strömt. Hier, fern vom Licht der Sonne und im Schutz harter Gesteinsschichten, gedeiht eine Kultur, die in Stein gemeißelte Beständigkeit mit verschlossener Zurückhaltung verbindet.
Leben in der Tiefe:
Die meisten Zwerge würden niemals freiwillig das Sonnenlicht sehen – nicht, weil sie es nicht können, sondern weil sie es nicht wollen. Die Oberfläche gilt als fremde, unberechenbare Welt. Nur in dringenden Ausnahmesituationen, etwa um Diplomaten zum oberirdischen Außenposten Khol Daral zu schicken oder um seltene Güter einzutauschen, wagt man sich nach oben. Es ist eine Ehre und Bürde zugleich, wenn ein Zwerg für die Obrigkeit an der Oberfläche handeln muss, denn der Glaube besagt: Verbleibt ein Zwerg zu lange fern von den Tiefen des Gesteins, verliert er den „Sinn für den Stein“. Man meint damit jenes feine innere Gespür, das die Zwerge mit der Erde verbindet – die Fähigkeit, die Qualität von Erz mit einem einzigen Schlag des Hammers zu erkennen, und die Intuition, den Klang einer bröckelnden Gesteinsschicht von stabilen Felswänden zu unterscheiden. Ein Zwerg, der diese Gabe verliert, wird von seinen Landsleuten mit Misstrauen und Mitleid zugleich betrachtet, denn er hat buchstäblich den Boden unter den Füßen verloren.
Architektur der Tiefe:
Die unterirdischen Städte, die als „Vurs “ (Die Städte Durvalkars) bezeichnet werden, bilden ein komplexes Netz aus Höhlenhallen, Schmiedekammern und Palastgewölben. Inmitten dieser erdverwobenen Welt liegt die Hauptstadt Vur Burim, ein Ort, an dem gigantische Säulen aus dem natürlichen Gestein zu kunstvollen Monumenten geformt sind, deren Oberflächen mit Runen, Fresken und reliefartigen Ahnenporträts verziert wurden. Unter feinem, bernsteinfarbenem Licht von Magmalampen glänzen Gänge und Marktplätze aus geglättetem Fels. Tiefere Ebenen verbinden sich durch die „Die Steinwege “: flache, breite Passagen, die von Wächtern patrouilliert, von Fuhrwerken befahren und von unterirdischen Flusssystemen durchschnitten sind.
Gesellschaft und Zusammenhalt:
Durvalkar ist eine Monarchie, in der ein König oder eine Königin von der Versammlung des Steines – einem Gremium aus Adligen und verehrten Handwerksmeistern – gewählt wird. Der gegenwärtige Herrscher, König Barogrin Steinhüter, verkörpert typische zwergische Tugenden: Härte, Klugheit und die Fähigkeit, notwendige Kompromisse einzugehen, ohne dabei die Ehre des Volkes zu verraten. Der Einsatz von Gewalt ist wohlüberlegt, und jeder Zwerg kennt seinen Platz im Kastensystem: von den einfachen Minenarbeitern über die legendären Schmiede und Steinschnitzer bis hin zu Händlern, Kriegern und Priestern. Sklaverei ist hier verpönt, denn Zwerge haben gelernt, dass nur eine feste Gemeinschaft den harten Bedingungen der Tiefe standhalten kann. (Das Kastensystem der Zwerge)
Allerdings ist diese Gemeinschaft in erster Linie nach innen gerichtet. Fremden begegnet man höflich, aber reserviert. Ein Zwerg denkt zuerst an sich und seine Sippe, bevor er an das Wohl eines Fremden denkt. Vertrauen ist eine Währung, die man in Durvalkar nur mit Mühe und zeitaufwendiger Verlässlichkeit erwirbt. Zwergische Händler mögen Handel treiben, doch verschenken sie keine Geheimnisse. Neue Bündnisse werden mit Bedacht geknüpft, und wer einmal die Ehre eines Zwergs verletzt, wird so schnell nicht wieder eingelassen.
Glaube an die Ahnen und den Stein:
Im Herzen ihres Glaubens stehen die Ahnen, deren Taten in Stein gemeißelt sind. Die Zwerge verehren ihre Vorfahren als Wegweiser und Beschützer, suchen Rat in den mystischen Hallen flüsternder Stalaktiten, wo Priester die Vibrationen im Gestein lesen. Man sagt, die Stimmen der Ahnen leben in den Adern des Felses weiter. Auch die Angst, oben auf der Oberfläche den Sinn für den Stein zu verlieren, entspringt diesem tiefen Glauben. Es ist, als ob die Kommunikation mit den Ahnen und die Verbindung zur Erde ein sensibles Band ist, das unter der offenen Himmelshaube rasch zerreißen kann.
Handwerk, Handel und Zurückhaltung:
Durvalkar ist bekannt für unübertroffene Handwerkskunst. Die Schmiede der Zwerge, tief in der Glut von Vulkanschloten und Lavaseen, formen Metalle und Mineralien zu Klingen, Werkzeugen und Rüstungen, die im ganzen Kontinent gesucht sind. Das geheimnisvolle Glitzern ihrer Legierungen, die Präzision der Runenarbeit und die Stabilität der geschmiedeten Werke sind legendär.
Dennoch drängen sich die Zwerge nicht auf. Sie agieren vorsichtig auf den internationalen Märkten. Mit Calvëndar, Velmorien und gelegentlich Aeris tauscht man Güter. Gegenstände aus Durvalkar sind teuer, aber immer ihren Preis wert. Der Ertrag der Handelsgeschäfte kehrt in die Tiefen zurück, um Bauten zu verschönern, Erkundungen neuer Gesteinsgänge zu finanzieren oder die Verteidigung gegen mögliche Gefahren aus der Unterwelt zu stärken.
Die Grenzen und Sicherung der Tiefe:
Die Zwerge sind sich bewusst, dass unter dem Berg nicht nur Schätze und Erz, sondern auch Bedrohungen lauern. Kreaturen der Tiefe, unkalkulierbare Erdbeben, magisch verseuchte Gesteinsschichten – all das erfordert Wachsamkeit. Streng disziplinierte Wachen, trainierte Milizen und spezialisierte Kundschafter sorgen dafür, dass die Gänge sicher bleiben. Im Gegensatz zur Oberfläche, wo Grenzen auf Landkarten gezogen werden, manifestieren sich die Grenzen der Zwerge als versiegelte Tunnel, abgesicherte Tore und versperrte Schächte. Eindringlinge und Monster sind eine ständige Gefahr, doch die Zwerge verstehen sich darauf, mit Stahl, Steinmagie und kluger Taktik ihre Welt gegen jede Herausforderung zu verteidigen.
Der Gletscherbund – Das Erbe der eisigen Stämme
Wo die eisigen Winde der Frostlande unablässig über schroffe Felsgrate und gefrorene Tundren peitschen, liegt das Land des Gletscherbundes (Die Städte des Gletscherbundes). Einst war diese Region ein Zerrspiegel aus blutigen Fehden, Rivalitäten und Raubzügen, in dem wilde Barbarenvölker sich um die kargen Ressourcen balgten. Doch aus einer Ära der endlosen Schlachten erhob sich eine neue Ordnung: Heute ist der Gletscherbund ein Zusammenschluss ehemaliger Barbarenstämme, die es geschafft haben, ihre althergebrachten Feindseligkeiten zumindest nach innen zu zügeln und ein Bündnis zu formen, das auf gemeinsamen Zielen und einem wachsenden Sinn für Gemeinschaft beruht.
Landschaft und Lebensweise:
Die Heimat der Gletscherbund-Völker ist ein Land der Extreme. Meterdicke Eisschichten, Fichtenwälder, deren Äste unter dem Gewicht des Schnees ächzen, und tiefe Schluchten prägen das raue Antlitz. Nahrung ist nicht im Überfluss vorhanden, sondern muss hart erjagt werden. Deshalb sind die Menschen hier furchtlose Jäger, die sich mit Speer, Bogen und Einfallsreichtum an Beute wie den gewaltigen Eisbären, zähen Rentieren oder seltenen Gletscherwölfen versuchen. Wer im Gletscherbund überleben will, muss Kälte, Hunger und Zähigkeit zum ständigen Begleiter machen.
Die Hütten in den Siedlungen sind aus grob behauenen Stämmen und dicken Tierhäuten gebaut, die vor dem klirrenden Frost schützen. Fackeln und Feuerstellen werfen warmes Licht auf dunkle Pfade. In den schneebedeckten Dörfern werden Met gesüßt, Felle gegerbt, Knochen zu Werkzeugen geschnitzt. Traditionelle Tätowierungen, Narben und Schmuck aus Tierzähnen erzählen Geschichten von Tapferkeit, Ahnenkult und der langen Reihe von Kriegern und Jägern, die das Land einst formten.
Von Stämmen zum Bund:
Die Menschen des Gletscherbundes waren früher Dutzende rivalisierender Stämme, jeder mit seinen eigenen Helden, Göttern und Häuptlingen (Die Städte des Gletscherbundes). Die Fehden zwischen ihnen waren ebenso heftig wie sinnlos. Doch vor wenigen Jahrzehnten, als ein besonders brutaler Winter die Stämme gleichermaßen heimsuchte, begannen einige Häuptlinge, in gegenseitigem Austausch Schutz, Nahrung und Wissen zu teilen. Nach anfänglichem Zögern entstanden Allianzen, und aus diesen Allianzen wurde ein lockeres Bündnis.
Heute ist der Gletscherbund ein Stammesrat, eine Versammlung der einstigen Häuptlinge und ihrer Vertreter. Ihre Hauptstadt, Helheim, ist das Herz dieses Bundes: ein Ort, an dem lange Holzhallen, Pfosten bemalt mit Runen und Siegernamen, und ein Zentralfeuer im Hauptrundgang den Rahmen für Beratungen bieten. Hier werden Ratschlüsse gefasst, Streitthemen erörtert und neue Bündnisse geknüpft. Obwohl noch immer ein Hauch von Misstrauen zwischen den Stämmen weht, ist die Erkenntnis gereift, dass Geschlossenheit Stärke bedeutet – vor allem in so unwirtlichen Breiten.
König und Herrschaft:
Ein König wird nicht einfach ernannt, er muss sich seinen Status in einem Turnier blutiger Härte erkämpfen. Jene Häuptlinge, die glauben, besonders würdig zu sein, messen sich in Kämpfen, Wettläufen über vereiste Ebenen, im Überleben in tiefster Kälte und im Jagen gefürchteter Bestien. Derjenige, der all diese Prüfungen übersteht und seine Rivalen bezwingt, trägt den Titel des Königs auf Lebenszeit. Doch die Krone im Gletscherbund ist kein sicherer Sitz: Jederzeit kann ein neuer Herausforderer auftauchen, jeder der Stämme darf einen Anwärter stellen. Gegenwärtig herrscht König Bjorn Eisspalter, ein bulliger Mann mit eisblauen Augen und einer Stimme, die selbst den Wind verstummen lässt. Er gilt als hart, aber nicht ungerecht, ein König, der weiß, dass jede Schwäche in diesem Land den eigenen Untergang bedeuten könnte.
Der Krieg gegen die Unheiligen der Bleichen Stadt:
Das Land des Gletscherbundes grenzt an eine unheimliche Ruine, bekannt als „Die bleiche Stadt“. Dort, so sagt man, lauern Untote in zerfallenen Gemäuern, und in rhythmischen Intervallen strömen Legionen von Skeletten und mumifizierten Kriegern heraus, als würden sie einer verfluchten Trommel folgen. Seit Generationen verteidigen die Stämme ihre Heimat gegen diesen Spuk. Was zunächst wie ein ewiger Fluch erscheint, hat im Gletscherbund eine seltsame Rolle angenommen: Es ist ein grausames, aber unvermeidbares Ritual des Erwachsenwerdens. Junge Krieger, die ihren Mut und ihre Geschicklichkeit unter Beweis stellen wollen, ziehen in den Kampf gegen die Untoten. Wer überlebt, kehrt mit Narben zurück, die von Ruhm künden. Wer fällt, wird in die Lieder der Ahnen aufgenommen, ein unvergessener Held. So bindet dieser Kampf viele Ressourcen, doch er formt auch den eisigen Geist des Volkes.
Veränderung durch Handel und Kontakte:
Erst seit kurzem wagt sich der Gletscherbund in die Gefilde der Zivilisation. Zwar sind die Sitten immer noch rau, aber der Gedanke, dass man durch Tauschhandel an Werkzeug, Stoffe oder Gewürze gelangen kann, fasziniert die einst so isolierten Stämme. Zwar bleibt Misstrauen gegenüber allzu geschliffenen Händlern bestehen, doch erste Handelsbeziehungen mit Calvëndar und vereinzelt mit Velmorien wurden geknüpft. Der Austausch von Fellen, seltenen Pilzen und eisigen Kräutern gegen Metalle, einfache Magie-Runen oder Getreide hat den Horizont der Gletscherbund-Bewohner erweitert. Man erkennt, dass es außer Ehre, Blut und Frost auch andere Werte geben kann, die ein Volk stärken.
Kultur, Glaube und Rituale:
Die Menschen des Gletscherbundes glauben an die Geister der Natur, an uralte Bestien, die in den Bergen schlummern, an Nordlichter, die die Seelen der Ahnen symbolisieren. Schamanen lesen in Tierknochen, um den Willen der Geister zu deuten. Lieder und Trommeln hallen in langen Winternächten durch die Holzhallen von Helheim. Kinder erlernen früh den Umgang mit Waffen, aber auch mit Kunsthandwerk: Geweihschnitzereien, bestickte Wintermäntel aus Wolfsfell und Talismanamulette sollen Glück und Stärke bringen.
Das zentrale Herzland
Calvëndar – Das Land der unbegrenzten Möglichkeiten
Calvëndar ist ein junges, aufstrebendes Reich im westlichen Herzen Loryndals – ein Ort, an dem Hoffnungen und Träume ihre Wurzeln schlagen können. Hier, wo man einst nur Exilanten, Verbannte und Halbelfen, die aus den stolzen Wäldern Calanvës verstoßen wurden, finden konnte, hat sich über die Jahrzehnte hinweg ein Schmelztiegel gebildet, der inzwischen als ein leuchtendes Vorbild für Freiheit, Offenheit und persönliches Wachstum gilt.
Ursprünge und Sinnbild der Freiheit:
Die Gründung Calvëndars war ein Akt des Widerstands gegen Rassismus, Unterdrückung und starre Tradition. Halbelfen, die in den isolierten Gärten Calanvës als „Unreine“ galten, und Menschen, die in ihrer Heimat keine Rechte oder Perspektiven hatten, fanden hier zusammen. Unter Führung der legendären Halbelfin Liora, einer Exilantin von adeliger Abstammung aus Calanvë, begannen sie im Schatten wogender Wälder und sanft geschwungener Hügel ein neues Reich aufzubauen. Ihre Vision: Ein Land, in dem jeder – ungeachtet von Abstammung, Geschlecht, Herkunft oder früheren Verfehlungen – eine zweite Chance erhält.
Landschaft und Städte:
Calvëndar erstreckt sich über ein Gebiet fruchtbarer Ebenen, grüner Wiesen und mäßig bewaldeter Hügel. Sanfte Flussläufe durchschneiden das Land, sorgen für ertragreiche Felder und lassen Blumenwiesen im milden Klima gedeihen. Die Hauptstadt Liora’s Wacht, benannt zu Ehren der Gründungsmutter, ist ein lebendiges Zentrum voller Märkte, Werkstätten, Gildenhäuser und Herbergen, in denen man Sprachen aus allen Teilen des Kontinents hört. Hier mischen sich zwergische Händler aus Durvalkar mit menschlichen Söldnern, gnomischen Alchemisten und halbelfischen Bognern. Neben Liora’s Wacht existieren vier weitere große Städte, jede mit ihrem eigenen Charakter und ihrer eigenen wirtschaftlichen Spezialisierung – zusammen bilden sie ein föderalistisches Netzwerk, in dem Konkurrenz und Gemeinschaftssinn nebeneinander gedeihen.
Regierungsform und Teilhabe:
Die calvëndarische Staatsordnung ist einzigartig. Anstelle einer Krone oder eines erblichen Titels steht hier ein Konzil aus zehn Vertretern an der Spitze:
- Zwei Halbelfen, gewählt von den Halbelfen des Landes, um ihre Stimme und Belange einzubringen.
- Zwei Menschen, die durch die Staatsbürgerschaft wählbar sind und so die menschliche Bevölkerungsmehrheit repräsentieren.
- Fünf Bürgermeister, je einer aus den fünf großen Städten des Reiches, die in regelmäßigen Abständen durch freie und offene Wahlen bestimmt werden. Jeder Bürgermeister ist nicht nur lokaler Lenker, sondern auch ein Botschafter der besonderen Kultur seiner Stadt.
- Eine Nachfahrin Lioras, derzeit Valendra Thelaria, als Sprecherin des Konzils. Sie soll den Gründungsgeist und die Ideale der ersten Tage bewahren, ist aber nicht unantastbar. Auch sie muss sich den Herausforderungen der Moderne stellen.
Diese Form der Machtteilung garantiert, dass kein einzelner Herrscher das Schicksal des Landes allein bestimmt. Entscheidungsprozesse mögen länger dauern, doch sie sind transparenter, integrativer und binden die Bevölkerung ein. Jeder Bürger kann etwas bewirken, sei es durch eine Bürgerinitiative, den Beitritt zur Fremdenlegion oder die Wahl des Stadtrats.
Die Fremdenlegion und Staatsbürgerschaft:
Die Fremdenlegion Calvëndars ist berühmt-berüchtigt. Wer ihr beitritt, erwirbt durch ehrenvollen Dienst an der Gemeinschaft das Recht auf Staatsbürgerschaft. Diese Legion ist ein bunter Haufen aus Söldnern, ehemaligen Kriminellen, visionären Abenteurern, Exilanten, sogar gescheiterten Diplomaten, die nirgendwo sonst Anklang fanden. Sie alle eint das Streben nach einem Neubeginn. Die Legion ist nicht nur ein militärischer Arm, sondern auch ein soziales Experiment: Jeder, der bereit ist, für das Land einzustehen, soll in ihm eine Heimat finden.
Gesellschaft und Kultur:
In Calvëndar tummeln sich Völker unterschiedlicher Herkunft. Halbelfen formen oft die kulturelle Avantgarde, sie bringen ihre feinfühlige Kunst, Musik und Poesie ein, die sie einst im Schatten Calanvës erlernt haben, nun aber frei entfalten dürfen. Menschen sind zahlreich, sichern die Grundversorgung und bringen ihre handwerklichen und landwirtschaftlichen Fähigkeiten ein. Exoten wie Halblinge, Gnome und sogar vereinzelte Orks aus Thol’Maruk (die mit Diplomatie ihren Weg hierher fanden) durchmischen das Bild. Diese Vielfalt führt zu spannungsreichen, aber produktiven Begegnungen.
Sklaverei ist strikt verboten. Der freie Wille und die Würde jedes Wesens stehen an erster Stelle. Arbeitskräfte finden sich genug, da Calvëndar für seinen wirtschaftlichen Aufschwung und seine individuellen Chancen bekannt ist. Wer hart arbeitet und kluge Ideen hat, kann hier vom einfachen Gesellen zum Gildenmeister, vom Tagelöhner zum Grundbesitzer aufsteigen. Gesetze fördern Unternehmergeist, Zünfte wachen über Qualität, doch Starre und Monopole sind selten – zu groß ist der Glaube an Wettbewerb und Innovation.
Handel und Diplomatie:
Als Land im Aufbruch ist Calvëndar ein lebhafter Handelsplatz. Wenige Beschränkungen und ein liberaler Markt ziehen Händler von nah und fern an. Vereinbarungen mit Durvalkar sichern eine konstante Lieferung hervorragender Metalle und Erzprodukte. Von Velmorien, einst Feind, bezieht man wertvolle Güter, Kunstwerke und Inspiration für juristische und soziale Reformen. Mit Aeris handelt man Kunsthandwerk, Spezialitäten und Delikatessen, wenngleich man die moralischen Grauzonen der Freien Stadt kritisch beäugt.
Calvëndar ist zwar weltoffen, dennoch nicht naiv. Diplomatie ist ein dauerndes Tauziehen, sei es, um die skeptischen Elfen von Calanvë wenigstens zu zögerlichen Handelsabkommen zu bewegen oder um die Praktiken Qualhazirs kritisch, aber respektvoll zu hinterfragen. Man versteht, dass Langfristigkeit und stetes Werben um Vertrauen Schlüssel zu stabilen Beziehungen sind.
Kunst, Wissen und Innovation:
Mit der Vielfalt kam auch ein geistiger Aufbruch. Gelehrte, Philosophen und Zauberer aus vielen Schulen haben in Calvëndar ein Zuhause gefunden. Hier diskutieren Halbelfenmagier mit menschlichen Alchemisten, hier wird in Bibliotheken das Wissen aus Prythania-Expeditionen katalogisiert, und Ideen für neue Technologie – etwa einfache Maschinen, die mit Runenkraft angetrieben werden – sprießen auf fruchtbarem Boden. Die calvëndarischen Musikabende, Festivals für Kunsthandwerk oder die inspirierenden Reden auf den Marktplätzen von Liora’s Wacht sind legendär.
Velmorien – Das alte Herz unter adliger Kontrolle
Velmorien liegt im Herzen Loryndals wie ein sorgsam gehütetes Erbstück aus längst vergangenen Tagen. Von außen betrachtet präsentiert sich das Reich als Hort von Bildung, Handel und Diplomatie – doch unter der polierten Oberfläche formt vor allem der Adel die Geschicke des Landes. Hier herrscht eine Erbmonarchie, deren Monarch und ein Netz aus adligen Familien den Takt vorgeben. Gerechtigkeit ist ein Wort, das zwar gern im Munde geführt wird, doch ob sie tatsächlich für alle gilt, entscheidet am Ende, wer Einfluss hat.
Geografie und der Frostwall:
Die sanft geschwungenen Hügel, fruchtbaren Felder und gesicherten Handelsrouten Velmoriens erzeugen ein Bild harmonischer Ordnung. Zentral im Reich thront die Hauptstadt Havenkrest, ein Knotenpunkt von Handel und Künsten, umgeben von befestigten Kleinstädten, Bauerndörfern und Manufakturen. An der nördlichen Grenze erhebt sich ein steinernes Bollwerk gegen vergangene Bedrohungen: der Frostwall. Einst zum Schutz vor marodierenden Stämmen aus den Frostlanden errichtet, dient er heute als sichtbares Symbol adliger Macht. Jahrhundertelang bewachten schwerbewaffnete Soldaten – angeführt von Söhnen adliger Offiziere – die Mauer und hielten Eindringlinge fern. Auch wenn die Bedrohung durch die nun im Gletscherbund vereinten Stämme nachgelassen hat, pocht der Adel darauf, die Mauer weiterhin schwer zu unterhalten: Sie ist ein Monument dafür, dass man den Wohlstand Velmoriens nicht dem Zufall oder dem Willen des gemeinen Volkes verdankt, sondern den klugen Entscheidungen der Elite.
Herrschaft und Adel:
An der Spitze Velmoriens steht ein Erbmonarch aus dem alten Adelsgeschlecht der von Arisenbergs. Der derzeitige Herrscher, König Alarion XIV. von Arisenberg, regiert mit fester Hand und legt Wert auf Hierarchien und Traditionen. Unter ihm entfaltet sich eine komplexe Pyramide einflussreicher Adelsfamilien, die Ländereien, Handelsrechte und hohe Ämter unter sich aufteilen. Der Hof ist ein Schachbrett von Interessen, Gunstbezeugungen, Seilschaften und stillschweigenden Abmachungen. Zwar gibt es ein ausgefeiltes Rechtssystem, doch die Beamten und Richter entstammen häufig adligen Reihen oder stehen in deren Schuld. Ein Bauer oder Handwerker hat vor Gericht formell die gleichen Rechte wie ein Adeliger, doch wer glaubt, dass dies auch in der Praxis gilt, gilt als naiv.
Kultur, Bildung und Machtkonzentration:
Velmorien ist kulturell hochentwickelt, zumindest in den Kreisen, die es sich leisten können. Havenkrest bietet Akademien, Theater und Bibliotheken, in denen Gelehrte diskutieren und junge Adlige ihre geistigen Fähigkeiten polieren. Literatur, Philosophie und Musik sind hochgeschätzt, allerdings bleiben diese Genüsse oft ein Privileg der Oberschicht. Die breiten Massen genießen zwar relative Sicherheit und Zugang zu Märkten, doch ihr Blick bleibt meist gesenkt, denn sozialer Aufstieg ist schwierig. Die Qualität des Handwerks ist hoch, aber wer die Produkte herstellt, darf selten über ihre Preise oder Absatzwege mitbestimmen.
Das Volk genießt durchaus einen gewissen Schutz: Das Reich ist geordnet, Räuberbanden werden verfolgt, Recht und Gesetz existieren – aber die Interpretation liegt meist in den Händen derjenigen, die im Namen des Königs auftreten. Kleinbauern, Pächter und auch Kaufleute mit geringem Einfluss wissen, dass sie sich besser nicht mit den falschen Familien anlegen. Skandale über Bestechungen, ungleiche Gerichtsurteile und verschwundene Beschwerdebriefe sind nicht ungewöhnlich, werden aber selten offen diskutiert.
Handel und Diplomatie als Adelsspiel:
Velmorien liegt strategisch günstig, sodass der Warenfluss von Durvalkars Schmiedekunst, Qualhazirs exotischen Gütern und Calvëndars vielfältigen Handelswaren durch seine Lande strömt. Doch während der Adel von den Zöllen, Handelsrechten und Privilegien profitiert, bleibt für die einfachen Händler oft nur ein magerer Rest. Protektionismus ist kein unbekanntes Wort: Wer ein dickes Beutelchen hat, kann sich schnell exklusive Handelslizenzen sichern, während kleinere Konkurrenz vom Markt gedrängt wird.
Diplomatie ist in Velmorien die Kunst der Adligen. Gesandte aus Havenkrest stimmen sich in opulenten Salons mit Abgesandten anderer Reiche ab. Allianzen werden hinter verschlossenen Türen ausgehandelt, manchmal mit einem edlen Tropfen Wein, manchmal mit subtilen Drohungen. Der Frostwall ist das älteste Denkmal für die Fähigkeit der Herrscher, sich vor äußeren Feinden zu schützen. Heute geht es eher um Kontrolle und Einfluss: Man schließt Abkommen, tauscht Geschenke aus und lächelt freundlich, während die andere Hand schon an den nächsten Trick denkt. Unterhalb dieser diplomatischen Bühne bleibt dem gemeinen Volk die Rolle des stummen Beobachters.
Glaube, Ordnung und Strenge:
Anders als in einer Theokratie ist Religion in Velmorien privat, doch die vorherrschenden Kulte – oft Götter des Rechts, der Weisheit oder des Wohlstandes – genießen insbesondere bei den Adligen Unterstützung. Tempel spielen eine Rolle in der Legitimation von Macht: Wer von den Göttern Wohlstand und Fruchtbarkeit erbitten kann, darf sich als gesegnet betrachten. Hohepriesterlichen Segen für Krönungen oder wichtige Hochzeiten erkauft sich der Adel durch reiche Spenden. Die unteren Schichten hoffen auf Gerechtigkeit, aber die Priesterschaft hält sich lieber an die, die den Geldbeutel voller haben.
Der staatliche Apparat funktioniert effizient genug, um Unruhen zu dämpfen. Harte Strafen erwarten jene, die offen gegen die Ordnung aufbegehren. Die Gesetze sind streng und detailliert, aber ihre Auslegung vollziehen Richter, die oft Adlige sind oder von ihnen abhängig. Der Adel rechtfertigt diese Ordnung mit dem Argument, dass nur durch eine klare Hierarchie Wohlstand gesichert werden kann. Das Volk hat sich weitgehend damit arrangiert: Einige murmeln Unmut in ihre Bierkrüge, andere ertragen die Ungleichheit mit stoischer Ruhe.
Das Südliche Festland und das vergessene Reich
Qualhazir – Das Sultanat der Ewigen Sande
Weit im Südosten Loryndals, wo die Winde des Kontinents in flirrenden Hitzegewalten ersticken, breitet sich Qualhazir aus – ein Land, das so exotisch wie gefährlich, so strahlend wie grausam und so reich wie ungerecht ist. Hier, im Reich der glühenden Sonne, erstreckt sich eine endlose Wüste, welche die Bewohner schlicht „Der Ewige Sand“ nennen. Er ist Lebensraum und Todesfalle zugleich, Schatzkammer und Gericht, ein Element, das den Charakter des gesamten Landes prägt.
Landschaft und Klima:
Qualhazir ist geprägt von endlosen Dünen, kargen Steinfeldern, vereinzelten Oasen und von Wüstenstraßen, die man nur mit geübtem Auge im Flimmern der Hitze erkennen kann. Die Hauptstadt Durg’Mora erhebt sich wie ein glitzerndes Juwel aus der Trockenheit: Über der Stadt thronen minarettartige Türme, kunstvoll geschnitzte Erker, Mosaiken aus leuchtenden Fliesen, während Händler und Händlerinnen in schattigen Basaren Gewürze, duftende Öle, edle Stoffe und kunstvolle Teppiche feilbieten.
Trotz der Schönheit der Stadt bleibt die Wüste stets präsent. Außerhalb der Mauern sind Karawanen auf schmalen Pfaden unterwegs, Kamelherden ziehen gemächlich durch die glühende Ebene, und die stete Gefahr, in einem Sandsturm die Orientierung zu verlieren oder von gierigen Räubern überfallen zu werden, sorgt für Nervenkitzel. Aus diesem Spannungsfeld von Glanz und Kargheit, Erfindungsgabe und Anpassung, erwächst der einzigartige Charakter Qualhazirs.
Regierungsform und Thronfolge:
Das Sultanat ist eine Monarchie ungewöhnlicher Art. Stirbt ein Sultan, so wird sein Amt versteigert – ein atemberaubendes politisches Ritual, bei dem reiche Händler, Adelige oder gewiefte Financiers um die Herrschaft bieten. Das höchste Gebot fließt als Mindesteinlage in die Staatskasse. Der neue Sultan darf diese Mittel vermehren und verwenden, doch nicht bedenkenlos verbrauchen. Am Ende seines Lebens geht das verbleibende Vermögen an seine Familie über. Hinterlässt er jedoch Schulden, so werden diese durch „Erbsklavschaft“ beglichen, eine bittere Bürde für seine Nachkommen.
Derzeit herrscht Sultan Menhir al-Salim, ein Mann, dessen Name auf allen Basaren geflüstert wird. Er ist bekannt für seine Liebe zum Luxus, aber auch für seine Gerissenheit im Umgang mit Intrigen. Obwohl es den Anschein hat, er sei ein Genießer von Reichtum und Pracht, munkelt man, er habe heimlich Söldnerbanden angeworben, um seine Position zu sichern und Rivalen im Keim zu ersticken. Zudem gilt er als Förderer der Wissenschaften, vor allem wenn sie ihm helfen, neue Wasserquellen in der Wüste zu erschließen oder Metalle zu entdecken, die den Wohlstand mehren.
Sklaverei und Handel:
Der Sklavenhandel ist Qualhazirs dunkles Rückgrat. Sklavenjäger durchstreifen die Wüste und die Grenzgebiete auf der Suche nach unvorsichtigen Reisenden oder wehrlosen Gemeinschaften. Auf den Märkten Durg’Moras werden Männer, Frauen und sogar Kinder wie Waren feilgeboten. Die Nachfrage ist groß, denn Sklaven dienen als Arbeitskräfte, Statussymbole oder exotische Kuriositäten. Dieses brutal-grausame System ist tief in die Ökonomie des Landes verankert und hat viele andere Reiche dazu gebracht, Qualhazir mit Misstrauen und Abscheu zu betrachten.
Gleichzeitig ist Qualhazir ein unersetzlicher Umschlagplatz für seltene Luxusgüter. Die Handelskarawanen transportieren Seide, Gewürze, Edelsteine und alchemistische Substanzen von der Qualität, die andernorts unbekannt ist. Zwar versuchen die Nachbarreiche häufig, den Einfluss dieser Märkte einzuschränken, doch die Sehnsucht nach exotischen Waren, Parfüms, opulenten Stoffen und seltenen Zutaten lockt immer wieder Händler in diese gefährliche Gegend.
Der Ewige Sand und die Festung Sandfeste:
An der Grenze zu Velmorien erhebt sich die Sandfeste, eine mächtige Wüstenburg, die einstmals als Barriere gegen Übergriffe diente. Hier, in kargen Mauern, stationieren qualhazirische Soldaten und Sklavenjäger, immer bereit, Reisende abzufangen und wertvolle Beute für die Märkte aufzutreiben. Die Festung hat ihren Zweck im Wandel der Zeiten geändert: Einst Verteidigungslinie, ist sie heute eher ein Kontrollpunkt, an dem die Qualhazirer ihre Macht demonstrieren und Handelnde einschüchtern.
Der Ewige Sand ist selbst eine Art unsichtbarer Herrscher über das Land. Unerbittlich fordert er seinen Tribut. Nur kluge Navigation, der Einsatz von Wegweisern, Oasen und gut trainierten Kamelen erlaubt das Reisen. Mythen sprechen von alten, untergegangenen Reichen unter dem Sand, von Djinnen, die Wünsche erfüllen, aber immer einen verborgenen Preis verlangen, und von Monstern, die im flimmernden Licht des Mittags erscheinen, als wären sie selbst aus Sand erschaffen.
Kultur, Religion und Wissen:
Die Kultur Qualhazirs ist ein Mosaik aus Farben, Düften und Geräuschen. Trommler, Lautenspieler und Tänzerinnen verzaubern bei Festen die Sinne, während Geschichtenerzähler Legenden von Untergang und Aufstieg, von wagemutigen Schatzsuchern und listigen Händlern in den Abendhimmel säuseln. Durg’Mora ist ein Hort der Dichtkunst und Philosophie, wo gelehrte Zirkel über die Geheimnisse des Sandes, den Wert der Freiheit oder den Charakter der Götter debattieren.
Anders als in streng strukturierten Monarchien gibt es hier keine Staatsreligion, doch Verehrung besonderer Gottheiten der Sonne, des Winds und des Handelns ist verbreitet. An kleinen Schreinen beten Händler für glückliche Karawanen, Sklaven flehen um Befreiung, und selbst der Sultan mag gelegentlich Opfer darbringen, um sein Schicksal zu lenken.
In versteckten Büchern und Archiven sammeln Gelehrte Kenntnisse über Wüstendüfte, Astrologie, seltene Heilpflanzen und die Kunst, Wasser aus dem Nichts zu gewinnen. Wer die richtigen Beziehungen hat, kann in Hinterzimmern auf Manuskripte stoßen, die möglicherweise Aufschluss über untergegangene Reiche geben, die noch älter sind als Prythania.
Prythania – Das Rätsel der verschwundenen Hochkultur
Tief in den östlichen Weiten Loryndals liegen die stummen Überreste einer längst vergangenen Zivilisation, deren Glanz und Größe heute nur noch schemenhaft im Flüstern des Windes und in brüchigen Ruinen erahnbar sind: Prythania. Einst soll dieses Reich auf dem Zenit seines kulturellen und wissenschaftlichen Schaffens gestanden haben, ein Ort, an dem Magie und Technik, Kunst und Philosophie zu einem schillernden Höhepunkt verschmolzen. Doch was immer hier einst gelebt, geschaffen, geforscht und geliebt wurde, verschwand vor langer Zeit auf rätselhafte Weise. Heute wandelt man durch verfallene Städte, als streife man durch die Schatten einer fremden Epoche, die eine warnende Geschichte erzählt: Hochmut, Geheimnisse oder gar eine kosmische Katastrophe könnten das Volk Prythanias ausgelöscht haben, doch niemand weiß es genau.
Landschaft und Überreste:
Die Ruinen von Prythania verteilen sich über eine weitläufige, oft neblige und verwilderte Gegend. Statt geordneter Felder findet man hier verkrümmte Baumreste, überwucherte Straßen, unterspülte Flussbetten und gespaltene Hügel. Als wäre die Natur selbst aus dem Gleichgewicht geraten, wachsen seltsame Pilze, farbenfroh, aber giftig, in den leeren Hallen, wo einst der Gesang von Gelehrten erklungen sein soll. Zerschmetterte Marmorportale, Reste kunstvoller Mosaike, Statuen ohne Köpfe, Säulen, die schräg in den Himmel ragen, oder ganze Tempelkomplexe, die vom Untergrund verschlungen werden – sie zeugen von vergangenen Meisterwerken.
Seltsam ist, dass es keine Spuren von Belagerungsmaschinen, Feuern oder Waffengewalt gibt. Die Ruinen wirken, als habe die Zeit selbst sie verschlungen, oder als sei ein unsichtbarer Schnitt durch die Geschichte gegangen. Manche dieser Orte liegen so still da, als würden ihre Bewohner jeden Augenblick zurückkehren – aber niemand kommt jemals zurück.
Mythen und Theorien:
In den Gelehrtenzirkeln Loryndals blühen Theorien über den Untergang Prythanias:
- Magische Katastrophe: Manche glauben, Prythania sei Opfer einer experimentellen Magie geworden. Möglicherweise spielte man mit Kräften, die jenseits des Verständnisses lagen, und eine unkontrollierbare Resonanz habe das Volk verschwinden lassen.
- Kultureller Verfall oder Bürgerkrieg: Andere erzählen, dass Prythania innerlich zerfressen war von Intrigen, standesübergreifenden Konflikten oder seltsamen Kulten, die schließlich zu einem vollständigen Zusammenbruch der Gesellschaft führten. Doch wo sind dann die Knochen, die Ascheschichten, die Werkzeuge der Zerstörung?
- Göttliche Strafe: Einige religiöse Orden behaupten, Prythania habe sich gegen die Götter gewandt, zu viel Stolz entwickelt, zu viele Tabus gebrochen. Der Zorn der Himmelsmächte soll das gesamte Volk auf einen Schlag ausgelöscht und die Städte leer zurückgelassen haben.
Da es so gut wie keine schriftlichen Quellen gibt – oder zumindest noch keine gefunden wurden – bleibt vieles Spekulation. Die wenigen pergamentartigen Fragmente, die man bergen konnte, sind in unbekannten Schriften verfasst, Symbole und Runen, deren Deutung sich selbst den klügsten Köpfen entzieht.
Gefahren und Mysterien:
Die Ruinen Prythanias sind kein Ort für Leichtsinnige. Expeditionen kehren oft nicht zurück. Sie berichten von seltsamen Wesen, geisterhaften Erscheinungen oder Kreaturen, die aus verirrter Magie geboren zu sein scheinen. Manche sprechen von lebenden Schatten, von Nattern aus purpurnem Rauch oder von mechanischen Konstrukten, die wie stumme Wächter in den verlassenen Hallen lauern. Hinzu kommen natürliche Gefahren: morsches Gestein, unterirdische Höhlungen, Erdrutsche oder giftige Gase machen jede Erkundung zur Lotterie.
Diejenigen, die zurückkehren, bringen gelegentlich Fragmente von Artefakten mit: kunstvoll verzierte Metallstücke, gläserne Behälter, in denen eine leuchtende Substanz schwappt, Bruchstücke von Schriftrollen, deren Runen leise glimmen, wenn man sie bei Vollmond betrachtet. Solche Funde sind bei Sammlern, Magiern und Herrschern heiß begehrt, denn wer das Geheimnis Prythanias lüftet, könnte sich Wissen sichern, das längst verloren geglaubt war.
Die Rolle der anderen Reiche:
Calvëndarische Gelehrte, velmorianische Archivare, zwergische Runenschmiede und sogar die Kirche der Weberin haben Interesse an Prythania. Expeditionen werden ausgesandt, teils unter dem Schutz von Söldnern, die für Fehburg-Klingen tief in die Tasche greifen, teils mit diplomatischer Rückendeckung der Freien Stadt Aeris, um wenigstens gefundene Schätze gut verkaufen zu können.
Doch niemand herrscht über diese Ruinen. Kein König, kein Sultan, keine Priesterin kann Anspruch auf Prythania erheben, ohne sich in Lebensgefahr zu begeben. Hier versanden die Ambitionen, hier führen Stolz und Ungeduld zu Untergang. Manch ein Abenteurer hat in Prythania seinen Glücksbringer verloren, oder fand dort das Ende seines Lebens.
Ein ewiges Rätsel:
Das Untergegangene Reich Prythanias schwebt in den Legenden Loryndals wie ein stiller Vorwurf: Es gab eine Zivilisation, mächtiger vielleicht als alle heute existierenden, und sie verschwand spurlos. Was bedeutet das für die Gegenwart? Ist es eine Mahnung, nicht zu hoch zu greifen? Ein Beleg, dass selbst der größte Fortschritt nicht vor dem Unbekannten schützt? Oder ist Prythania einfach nur ein kosmischer Unfall, ein Mysterium, das niemals gelöst werden wird?
Solange die Trümmer stehen, solange Nachtwinde über zerbrochene Arkaden heulen, bleibt Prythania ein Spiegel, in dem jedes gegenwärtige Reich seine eigene Vergänglichkeit erahnen kann. Und so ziehen weiterhin Abenteurer, Gelehrte und Glücksritter in dieses verlassene Land, um Antworten zu suchen – und riskieren dabei, für immer in seinen stummen Hallen zu verhallen.
Die Nördlichen Inselreiche
Thol’Maruk – Das Exil der Orks
Nördlich, jenseits der hart umkämpften Frostlande, liegt eine Insel, die einst nur als karges, windgepeitschtes Eiland bekannt war: Thol’Maruk, die letzte Heimat der Orks. Dieses Volk hat eine lange und blutige Geschichte hinter sich. Wo sie einst im Herzen des Kontinents hausten, Schlachten schlugen und sich in waghalsigen Kriegen gegen die etablierten Reiche auflehnten, ist ihnen heute nur ein abgeschiedenes Refugium geblieben. Exil ist ihr Los, Verbannung ihre bittere Lektion.
Herkunft und Niedergang:
Vor über einem Jahrhundert kämpften die Orks in vier großen, vernichtenden Konflikten um die Vorherrschaft in den Frostlanden und darüber hinaus. Diese Auseinandersetzungen, die man heute meist ehrfürchtig als die „Kriege der Blutpfade“, die „Knochenfeuer-Konflikte“, die „Schwarzkamm-Offensiven“ und die „Stürme der Wolfskralle“ bezeichnet, kosteten Tausende von Leben und formten das Bild der Orks als furchterregende Eroberer. Doch sie waren kein einig Volk: Auf gespaltene Sippen, widersprüchliche Anführer und taktische Fehlentscheidungen folgten verheerende Niederlagen gegen vereinte Kräfte der menschlichen, zwergischen und anderen Völker.
Aus ihrem alten Land vertrieben, blieb den Orks am Ende nur Thol’Maruk – ein öder Fels im Meer, umgeben von tückischen Strömungen und Eisschollen. Hierhin trieb man sie, hier verhungerten sie beinahe im ersten Winter ihrer Verbannung, und hier erzwang die Kargheit einen Wandel.
Das Leben im Exil:
Thol’Maruk ist kein fruchtbares Land. Die Böden sind steinig, die Vegetation spärlich, und die Jagd ist mühselig. Einzige nennenswerte Siedlung ist Kodagog, eine zähe, improvisierte Stadt aus hölzernen Hütten, Tierfellen und Steinen. Kodagog war zunächst nichts als ein zerlumpter Treffpunkt geflohener Clans, die sich gegenseitig beäugten und an vergangene Erbfehden erinnerten. Doch mit der Zeit mussten sie erkennen, dass das Überleben hier nur durch Zusammenarbeit möglich war. Die einst stolzen Kriegsherren wurden zu Fischern, Sammlern, Handwerkern.
Was zunächst wie totale Erniedrigung erschien, schuf langsam etwas Neues: Die Orks lernten, auf ihre Nachbarn zu hören, Wissen zu teilen, Handel zu treiben. Wenn auch mit Widerwillen, verstanden sie, dass die alte kriegerische Großmannssucht ihnen nur Elend eingebracht hatte. Kodagog ist heute ein Ort, an dem man die Spuren dieses inneren Wandels sehen kann: Kleine Handwerksstände, ein Schamanenkreis, ein Treffpunkt für Geschichtenerzähler, in dem alte Mythen und Lehren neu bewertet werden.
Gesellschaft und Hierarchie:
Die Orks folgen noch immer einer archaischen Stammeshierarchie: Stärke, Mut und Ausdauer zählen viel. Doch es hat ein Umdenken stattgefunden. Rein körperliche Kraft reicht nicht mehr, um Häuptling zu werden. Immer häufiger setzt sich durch, wer auch Verhandlungsgeschick, Weitsicht oder handwerkliches Können mitbringt. Anführer, die nur drohen und brüllen, finden sich zunehmend isoliert.
Derzeit führt ein Häuptling namens Goraz Wildfaust die Orks. Goraz ist kein bloßer Berserker, sondern jemand, der – so raunen die Orks hinter vorgehaltener Hand – heimlich liest, rechnen kann und versucht, diplomatische Bande neu zu knüpfen. Unter seiner Führung sind erstmals seit Jahrzehnten Boten zu anderen Völkern geschickt worden. Das Misstrauen, das ihnen entgegenschlägt, ist gewaltig, doch nach langen Verhandlungen wurden erste Handelsabkommen geschlossen, unter anderem mit einzelnen Stämmen des Gletscherbundes und sogar mit Calvëndar.
Wandel durch Wissen und Diplomatie:
Seit zehn Jahren spürt man einen überraschenden Aufschwung in Thol’Maruk. Einfache Schulen wurden gegründet, in denen Schamanen Runen und Zahlen lehren. Junge Orks lernen nicht nur, ein Beil zu schwingen, sondern auch, einen Streit verbal zu lösen oder die besten Fangmethoden für winterliche Fischschwärme zu nutzen. Man entwickelt primitive Boote, um vorsichtig Handel zu treiben oder seltene Materialien von benachbarten Inseln zu beziehen.
Diplomatie ist für die Orks ein neues Feld. Einst war ihr Ruf, derart bedrohend und barbarisch, dass man sie ohne Zögern niederschlug, wo immer sie auftauchten. Doch Goraz Wildfaust versucht, alte Feindschaften zu mindern. Es gab Treffen mit calvëndarischen Abgesandten, bei denen einfache Ork-Werkzeuge gegen Stoffsäcke und Körner eingetauscht wurden. Zwar trauen noch immer viele Völker den Orks nicht, doch der Funken des Wandels ist entfacht.
Kultur und Erinnerung:
Trotz ihres Wandels vergessen die Orks ihre Vergangenheit nicht. In den langen Winternächten versammeln sie sich um Feuerstellen, um Lieder von alten Helden und verhängnisvollen Schlachten zu singen. Doch diese Erzählungen klingen heute anders: Es ist mehr Wehmut als Stolz. Sie erzählen von verschwendetem Mut, von verlorener Ehre, die nicht in Schlachten, sondern in der Endgültigkeit des Exils liegt.
Die Alten wollen die Jungen lehren, dass Kampf allein nicht genügt. Neue Mythen entstehen: Geschichten von Orks, die durch Wissen und Verstand mehr erreichten als durch die Axt. Der Schmerz der Niederlagen ist tief, aber er dient jetzt als Lehre, dass Überleben auch Anpassung bedeutet.
Herausforderungen und Hoffnungen:
Thol’Maruk ist weit entfernt von einer Erfolgsgeschichte. Armut, Mangelernährung, raue Winter und interne Machtkämpfe zwischen jenen, die den alten Weg zurückwollen, und jenen, die den neuen Pfad beschreiten, plagen das Volk. Doch in den Augen vieler Orks leuchtet eine neue Hoffnung. Wenn sie es schaffen, sich an diese raue Insel anzupassen, wenn sie lernen, mit anderen Völkern zu handeln, wenn sie beweisen, dass sie nicht mehr die alten Eroberer sind – vielleicht öffnet sich ihnen dann eine Zukunft, in der ihr Name nicht mehr nur Schrecken verbreitet.
Die Kirche der Weberin
Abseits der großen Kontinente, auf einer abgelegenen Inselgruppe nördlich in den kalten Meeren Loryndals, erhebt sich das Domizil der Kirche der Weberin – ein streng matriarchalischer Gottesstaat, der seine Macht aus dem Glauben an die Weberin schöpft. Diese mythische Gestalt, von den Priesterinnen als Schöpferin aller Existenz verehrt, soll die Welt aus den unsichtbaren Fäden des Schicksals gewoben haben. Hier, an den Hängen des inaktiven Vulkans, der den klangvollen Namen „Die Wiege“ trägt, beherrscht ein Glaube die Herzen und Gedanken: Alles ist Teil eines kosmischen Wandteppichs, den die Weberin unermüdlich webt – und wer sich gegen ihr Muster stellt, darf auf keine Gnade hoffen.
Geografie und Hauptstadt:
Die Insel, auf der die Kirche thront, ist von rauen Klippen, kalten Winden und tiefblauen Gewässern geprägt. „Die Wiege“ – ein ruhender Vulkan – steht im Zentrum wie ein gewaltiger Fingerzeig der Götter. An seinen Flanken klettern terrassenförmige Felder empor, in denen die Priesterinnen seltene Kräuter anbauen, die sie für Rituale und Arzneien benötigen. Immer wieder stößt der Berg leichte Dampfwolken aus, als würde er leise schlummern.
Umschlossen wird diese Szenerie von verwitterten Mauern, hohen Obelisken und klar gegliederten Prozessionswegen, die alle zur Hauptstadt führen: „Die Spindel“. Die Spindel ist mehr als nur eine Stadt – sie ist ein geweihter Ort, an dem jede Gasse, jeder Brunnen und jedes Haus Teil eines religiösen Mosaiks ist. Weiße Marmortempel, geschmückt mit filigranen Reliefs von Fäden, Spindeln, Webstühlen und Frauengestalten, reihen sich um den zentralen Hoftempel, in dem die Hohepriesterin residiert. Es ist ein Ort der Reinheit und Ordnung, an dem Fremde schnell spüren, dass sie auf heiligem Boden wandeln.
Herrschaft, Glaube und Geschlechterordnung:
Die Kirche der Weberin ist eine Theokratie, in der der Klerus – ausschließlich bestehend aus Frauen – das Sagen hat. An der Spitze steht die Hohepriesterin, derzeit Mutter Seraphina von den Seidenwegen, deren Amt bis zum Tod währt. Nur Frauen können Priesterinnen werden, nur Frauen können die mystischen Riten vollziehen, nur sie können die Fäden lesen, die die Weberin in das Gewebe der Welt zieht. Männer sind zwar nicht grundsätzlich geächtet, doch sie stehen auf der sozialen Leiter deutlich tiefer, nur im Militär können sie die soziale Leiter wirklich hochsteigen. Für viele zählt die Kirche den Wert eines Mannes vor allem danach, ob er nützlich ist. Ist er arm oder mittellos, kann es geschehen, dass er zum praktischen „Eigentum“ reicher Anhängerinnen wird – ein Graubereich der Gesellschaft, in dem Abhängigkeit und faktische Unfreiheit herrschen, obwohl Sklaverei offiziell verboten ist.
Das Matriarchat ist streng: Wer gegen die Weberin lästert, die Priesterinnen beleidigt oder die Heiligkeit der Wiege in Zweifel zieht, muss mit schweren Strafen rechnen. Blasphemie gilt als todeswürdiges Vergehen. Die Kirchengesetze sind kompliziert, doch einfach zu umreißen: Folge den Wegen der Weberin, hinterfrage nicht ihre Motive, unterwirf dich dem kosmischen Muster.
Rituale und Religiöse Praktiken:
Mehrmals im Jahr finden aufwändige Zeremonien statt, in denen die Priesterinnen mit kunstvollen Gewändern aus feinster Seide, die in allen Farben des Regenbogens schillern, um die Spindel schreiten. Sie singen in alten Zungen, opfern rare Kräuter und symbolische Stoffbahnen, um die Weberin milde zu stimmen. Die Weberin ist keine launische Gottheit, so sagen sie, sondern eine Schöpferin, die geduldig Faden um Faden legt. Doch wer sich ihrem Muster entzieht, destabilisiert das Gefüge der Schöpfung.
Die Wiege gilt als heiliger Ort, an dem einst die Macht der Weberin erstmals spürbar gewesen sein soll. Risse im Fels und eingelassene Runensteine dienen Priesterinnen als Orakel. Wer die Erlaubnis erhält, diese Halle der Fäden zu betreten, kann darin die Zitterbewegungen der Erdkammern spüren, die angeblich direkt mit den kosmischen Fäden in Resonanz stehen. Der Glaube an die Weberin ist nicht nur Religion, sondern Gesetz, Kultur und Identität.
Militär und Ausbreitung des Glaubens:
Entgegen dem Bild friedlicher Spinnerinnen besitzt die Kirche ein starkes Heer. Disziplinierte Kriegerinnen, oft von Priesterinnen in Kampfkunst und Glaube geschult, halten die Grenzen und sichern den Einfluss der Kirche und hier können auch Männer ihren Wert beweisen und in der Gesellschaft aufsteigen. Zwar ist es eine Insel, doch man scheut nicht davor zurück, Schiffe auszusenden, um in fernen Reichen Missionen zu etablieren. Ihre Abgesandten – ausschließlich Priesterinnen und kriegskundige Klerikerinnen – unterhalten in vielen anderen Ländern kleine Schreine oder diplomatische Häuser. Die Kirche ist diplomatisch geschickt: Überall, außer im Elfenreich Calanvë, versucht sie, Fuß zu fassen. Ihre Botschafterinnen bieten Heilkunst, Prophezeiungen und religiöse Beratung an, im Gegenzug versuchen sie, den Einfluss des Weber-Glaubens zu festigen.
Manche Herrscher:innen sind froh, die Priesterinnen in ihrer Hauptstadt zu haben, denn sie versprechen Schutz und Wohlstand, solange man den Lehren nicht widerspricht. Andere fürchten die moralische Strenge, die Angriffe auf das lokale Brauchtum. Währenddessen spielt die Hohepriesterin ein diplomatisches Spiel: Sie spinnt Fäden ins Ausland, spinnt Netze aus Abhängigkeiten, baut Brückenköpfe, um die Lehre der Weberin als alternativlose Wahrheit darzustellen.
Herausforderungen und Risse im Glauben:
Doch nicht alles ist so glatt gewebt, wie die Kirche es vorgibt. In den hintersten Winkeln der Insel munkelt man von Männern, die die Ordnung in Frage stellen, von Frauen, die an der absoluten Strenge zweifeln. Vereinzelt gibt es Stimmen, die die unnachgiebige Haltung der Kirche gegenüber Fremden kritisieren oder die Härte der Strafen für Blasphemie anzweifeln. Diese Stimmen flüstern nur im Dunkeln, denn offen gegen die Weberin und ihre Priesterinnen aufzubegehren, ist selbstmörderisch.
Auch in der Außenpolitik stößt der Fanatismus der Kirche gelegentlich auf Widerstände. Manche Reiche wollen keinen Einfluss der Weberin in ihren Mauern. Sie fürchten, die Priesterinnen könnten Unruhe säen oder ihre Bevölkerung indoktrinieren.
Die Südlichen Inselreiche und Freistädte
Calanvë – Das isolierte Elfenreich der reinen Blutlinie
Calanvë ist eine Welt für sich. Auf einer abgeschiedenen Insel, durch von Nebeln umwobene Küsten und dichte Wälder geschützt, haben die Elfen ein Königreich erschaffen, das so alt und erhaben ist, wie die mächtigen Baumriesen, aus deren Hölzern sie ihre Bauten schufen. Doch wo andere Reiche Allianzen, Austausch und Verständnis suchen, verschließt sich Calanvë hartnäckig. Es ist ein Land der Reinheit, in dem uralte Blutlinien sorgfältig bewahrt werden. Hier herrschen stolze, ja offen xenophobe Elfen, die kaum etwas von der Welt jenseits ihrer Grenzen wissen wollen – oder müssen.
Landschaft und Hauptstadt:
Die Wälder Calanvës sind ein Mosaik aus smaragdgrünen Kronen, alten, moosbewachsenen Stämmen und sanften Lichtungen, in denen Sonnenstrahlen wie goldene Pfeile niedergehen. Flußläufe und Wasserfälle weben ein natürliches Klangteppich, Vogelrufe und das Flüstern des Windes ersetzen den Marktlärm anderer Reiche.
Tief in diesen Wäldern liegt Sylvandril, die Hauptstadt, ein Ort von atemberaubender Schönheit. Ihre Gebäude sind nicht aus Stein, sondern in Harmonie mit der Natur gestaltet: Baumhäuser, filigrane Holzbrücken, kunstvolle Laubdächer und lichte Hallen, in denen Elfenchöre singen und Meisterharfner ihre Saiten erklingen lassen. Es heißt, kaum ein Nicht-Elf hat je Sylvandril gesehen – ein Gerücht, das stolz kolportiert wird, um die Abgeschiedenheit und Reinheit des Elfenreiches zu unterstreichen.
Regierung, Blutlinien und die Drei Mütter der Natur:
Calanvë wird von einem König regiert, doch seine Wahl ist nicht zufällig oder erblich in der männlichen Linie begründet. Stattdessen wird er durch die Drei Mütter der Natur bestimmt, ein aus Urzeiten stammendes Matriarchat dreier hoher Priesterinnen, jede Nachfahrin einer der drei mythischen Weltengründerinnen. Diese drei Mütter geben ihre Ämter stets an ihre ältesten Töchter weiter, um die heilige Blutlinie zu bewahren. Sollte eine Mutter keine Tochter gebären, gilt dies als unheilvolles Zeichen – dann muss eine Tochter adoptiert werden, eine Entscheidung, die mit dunklen Vorahnungen behaftet ist.
Wenn der König stirbt oder abdankt, verkünden die drei Mütter, welcher Elf den Thron besteigen soll. Derzeit regiert König Thalendrell Lindriol, ein Elfenherrscher von rauer Eleganz und unnahbarer Miene. Man sagt, er versteht die subtile Sprache des Waldes, spürt die Energien alter Baumschrate und flüstert mit den Geistern der Ahnen. Seine Rolle ist die eines Mittlers zwischen den Müttern, die den spirituellen Kern der Gesellschaft bilden, und den weltlichen Bedürfnissen seines Volkes.
Xenophobie und Isolation:
Calanvë ist für Außenstehende nahezu unerreichbar. Die Elfen dulden kaum Fremde in ihren Wäldern. Sie sind überzeugt von der Überlegenheit ihrer reinen Blutlinie und betrachten Halbelfen als abstoßende Perversion, ein unreines Erbe schwacher Völker. Orks, Menschen, Zwerge – für die Elfen sind sie primitive Fremdkörper, die jenseits der See bleiben sollen. Einzige Ausnahme ist Eichenhafen, ein Außenposten auf einer vorgelagerten Insel, der als Pufferzone dient. Hier können Händler aus anderen Reichen unter strengen Auflagen Waren austauschen, doch die eigentliche Heimat der Elfen bleibt verschlossen.
Diese Isolation manifestiert sich nicht nur im Handel, sondern auch im Umgang mit Wissen. Die Elfen Calanvës hegen kein Interesse an den Entwicklungen in Calvëndar, den politischen Ränken Velmoriens oder den mysteriösen Ruinen Prythanias. Sie sehen alle anderen Völker als aufrührerische, unstete oder unsaubere Mischungen an, die ihnen nichts beizubringen haben, das die makellose Reinheit ihrer Kultur übertreffen könnte.
Kultur, Glaube und Lebensart:
Das Leben in Calanvë folgt dem Rhythmus der Natur. Es gibt keine Sklaven und auch keinen offensichtlichen Zwang – zumindest nicht unter Elfen. Alle Arbeiten, von der Jagd über das Korbflechten bis zur Alchemie mit seltenen Waldkräutern, werden mit einer Kunstfertigkeit ausgeführt, die tief im kulturellen Gedächtnis verwurzelt ist. Die Trennung in soziale Klassen ist fließend, doch Halbelfen oder andere Mischrassen haben hier keinen Platz und werden, falls jemals entdeckt, rigoros verbannt.
Die Elfen ehren die Natur, die Bäume, Tiere und Geister ihres Waldes. Jene, die Magie wirken, tun es in leisen Gesängen, verflechten Zauber mit Wurzeln und Blüten, lassen Heilkräfte durch Quellwasser fließen. Kein lärmender Stahl, kein Schrei des Leidens soll den grünen Dom der Heimat beflecken. Solche Ideale klingen erhaben, doch sie gehen Hand in Hand mit Arroganz: Wer nicht in dieses feine Gleichgewicht passt, wird ausgeschlossen.
Kein Raum für Veränderung:
Während andere Reiche sich wandeln, Beziehungen knüpfen, voneinander lernen, verharrt Calanvë in einer selbstgewählten Blase. Während Calvëndar seine Tore öffnet, Aeris mit allen handelt, Velmorien diplomatische Netze knüpft und der Gletscherbund sich langsam zivilisiert, bleibt Calanvë in seiner grünen Festung. Manche Elfen zählen genau dies zu ihrer Größe: Sie müssen nicht wachsen, weil sie bereits perfekt sind. Andere, seltene, kritisch denkende Elfen flüstern jedoch, dass Stillstand auch Verfall bedeuten könnte. Diese Zweifler sind jedoch so selten wie weiße Hirsche in der Nacht.
Die freie Stadt Aeris – Die Freie Stadt zwischen Goldgier und Diplomatie
Aeris ist wie ein fein geschliffener Edelstein inmitten rauer Gewässer: auf den ersten Blick funkelt sie verlockend in allen Farben des Reichtums und der Kultiviertheit, doch wer näher tritt, erkennt schnell, dass hinter der schimmernden Fassade Gier, Korruption und harte Kämpfe um Einfluss lauern. Diese Stadt ist kein Reich, kein Sultant und kein Zusammenschluss verschiedener , sondern eine unabhängige Handelsmetropole. Ein neutraler Hafen für Diplomaten, Schmuggler, Piraten, Adelige, Söldner und jeden, der genug Gold hat, um sich Gehör oder Schutz zu erkaufen.
Lage und Erscheinungsbild:
Aeris liegt auf einer Insel südlich der Herzlande, ein strategischer Knotenpunkt zwischen wichtigen Seerouten und den Handelszentren Loryndals. Der Hafen ist riesig, voll beladener Schiffe, bunter Segel und lauter Marktschreier. Die Stadt selbst schmiegt sich an eine Anhöhe, auf der reich verzierte Handelshäuser, Kontore, Gilden- und Zunfthallen dicht an dicht stehen. Spaziert man durch Aeris, fallen bunte Banner, exotische Warenstände und ein ständiges Stimmengewirr auf. Hier mischen sich Dialekte aus Durvalkar, Velmorien, Calvëndar, Qualhazir und anderen Teilen der Welt.
Hinter dem vordergründigen Glanz zeigt sich aber auch das Elend: Die armen Viertel liegen in schattigen Gassen, wo sich Tagelöhner drängen und Bettler um Brotkrumen streiten. Jede Münze hat zwei Seiten, und in Aeris sieht man sie besonders deutlich.
Regierung und Erbfolge:
Aeris ist offiziell ein Freihandelshafen, geleitet von einer Herrscherfamilie, deren Oberhaupt sich Münzvogt nennt. Aktuell thront Münzvogt Alaric Seindorn über den Reichtum der Stadt. Hier fließen Zölle, Steuern und Schutzgelder zusammen, und die Macht des Münzvogts ist groß. Doch anders als in einem Erbreich entscheidet im Hintergrund das Gold, wer diesen Titel behaupten kann. Zwar wird er formal vererbt, doch wer die Münze und den Einfluss besitzt, kann Abkommen und Schuldscheine nutzen, um den Erben frühzeitig zu beeinflussen oder gar zu verdrängen. Offiziell ist nichts davon legal, doch Gesetz und Gerechtigkeit sind in Aeris dehnbare Begriffe.
Der Münzvogt verhandelt mit Gilden und Konsortien, schließt Absprachen mit mächtigen Händlerfamilien und erhält so seine Stellung. Die „Unterhändler“ – eine Gruppe beratender Finanziers, Broker, Diplomaten und Söldnerführer – unterstützen oder untergraben den Münzvogt je nach Vorteilslage. Ein fein austariertes System von Versprechungen und Schmiergeldern hält diesen Balanceakt aufrecht.
Wirtschaft und Handel:
In Aeris trifft sich die Welt. Waren, die man anderswo kaum kennt, wechseln hier ihren Besitzer. Die Steuern sind niedrig, die Kontrollen lax, und fast jede Art von Geschäft ist möglich. Die Stadt hat sich als neutraler Boden etabliert, weshalb Herrscher, Piratenkapitäne und Schmugglerfürsten gleichermaßen verhandeln. Hier kann ein König aus Velmorien diskret seine Klingen von Fehburg-Kriegern kaufen, während ein Kalif aus Qualhazir seltene Gewürze mit calvëndarischen Händlern austauscht. Auch verbotene Waren finden ihren Weg nach Aeris – und es interessiert kaum jemanden, solange der Profit stimmt.
Die Stadt zieht daher Abenteurer und Glücksritter magisch an, denn wer den richtigen Deal macht, kann in kurzer Zeit reich werden. Doch genauso kann man alles verlieren, wenn man die falschen Geschäftspartner wählt. Betrug, Hinterlist, Auftragsmorde und Erpressungen gehören zum Alltag, werden aber selten offen geahndet. Stattdessen sichern sich Händler und Magnaten durch private Söldner ab.
Sicherheit durch Söldner:
Das Gewaltmonopol in Aeris liegt nicht bei einer ehrbaren Stadtwache, sondern bei Söldnern, die für den Münzvogt und seine Unterhändler arbeiten. Diese „Stadtwache“ wahrt in erster Linie die Ordnung, die den Geldfluss nicht stört. Wer genug zahlt, bekommt Schutz. Wer sich Feinde macht, findet vielleicht am nächsten Morgen einen Dolch in der Tür.
Hinter vorgehaltener Hand wird gemunkelt, dass die Wachen mehr an ihrem eigenen Profit interessiert sind als an der Sicherheit der Bürger. Korruption ist an der Tagesordnung, und wenn zwei Großhändler in Streit geraten, können die Wachen gegen eine kleine Spende gewogen werden, „das Richtige“ zu tun. Das Resultat: die Illusion von Recht und Ordnung, die nur so lange hält, wie niemand das System zu sehr ausreizt.
Sklaverei und Moral:
Offiziell ist Sklaverei in Aeris verboten. Doch was heißt schon verboten, wenn der Handel mit Leibeigenen aus Qualhazir oder anderen Ländern hier floriert? Sklaven dürfen zwar nicht offiziell gehalten und eingesetzt werden, doch Transit, Verkauf und Weiterleitung von Sklaven finden in Hinterhöfen und auf Privatpiers statt. Die schlupfrigen Gesetzeslücken erlauben den Handel, solange die Sklaven nicht als solche in der Stadt dienen.
Die Tagelöhner in Aeris, die oft für einen Hungerlohn schuften, leben kaum besser als Sklaven. Kein Gesetz schützt sie vor Ausbeutung durch mächtige Gilden. So entsteht eine subtile Heuchelei: Nach außen präsentiert sich Aeris als freier, neutraler Hort des Handels, aber tatsächlich herrscht knallharte soziale Ungleichheit. Wer kein Geld hat, ist hier kein aufstrebender Freigeist, sondern Kanonenfutter in den Intrigen reicher Händler.
Diplomatie und Einfluss:
Trotz all dieser Schattenseiten ist Aeris für viele die ultimative neutrale Zone. Wenn zwei verfeindete Reiche einen Waffenstillstand aushandeln wollen, wenn Schmuggler mit Königen flüstern, wenn Diplomaten einen vertraulichen Deal abschließen müssen – alle kommen nach Aeris, um auf neutralem Boden zu verhandeln. Hier herrscht ein ungeschriebenes Gesetz: Die Stadt ist demilitarisiert, und offene Kriegsführung wird nicht geduldet, weil es das Geschäft ruinieren würde. Wenn auch von selbstsüchtigen Motiven getrieben, sorgt diese Neutralität dafür, dass sich die Mächtigen zumindest an einem Ort auf Augenhöhe begegnen.
Das Protektorat Fehburg – Die Festung der Unbesiegbaren
Auf einer kargen Insel östlich der Freien Stadt Aeris, umspült von graugrünen Wogen und fernab der üblichen Handelsrouten, ragt eine uneinnehmbare Bastion aus steilen Felsklippen: Fehburg, der Sitz des gleichnamigen Protektorats. Kein Reich, kein König und keine Allianz hat je auch nur einen Ziegelstein dieser mächtigen Festungsanlage verrücken können. Hier leben und sterben die besten Krieger des Kontinents, Männer und Frauen, deren Name schon ausreicht, um ganze Armeen erzittern zu lassen.
Lage und Unnahbarkeit:
Fehburg steht wie ein Monument des Krieges auf einer vom Wind gepeitschten Insel. Die Mauern aus schwarzem Basalt, verstärkt mit seltenen Metallen, sind so massiv, dass selbst Belagerungsmaschinen in den vergangenen Jahrhunderten kaum Kratzer hinterließen. Das Umland ist karg, die Böden sind steinig und wenig fruchtbar. Die Gemeinschaft, die hier lebt, ist auf strenge Disziplin und militärische Effizienz angewiesen, um sich zu versorgen. Lebensmittel werden sorgfältig eingelagert, jedes Tier, jede Pflanze ist Teil eines ausgeklügelten Versorgungssystems.
Gesellschaft und Rangordnung:
Fehburg ist ein reiner Militärstaat. Die gesamte Bevölkerung dient in irgendeiner Form den Bedürfnissen des Krieges oder der Kriegerkaste: Waffenschmiede, Bogenmacher, Heilerinnen, Fährleute, Späher – alle arbeiten darauf hin, die Kampfkraft der Garnison hochzuhalten. Hier zählt keine Adelslinie, kein ererbter Titel, sondern nur die Leistung im Kampf und in der Logistik. Die Gesellschaft ist geprägt von Pflichterfüllung, Ehre und der stillschweigenden Übereinkunft, dass Schwäche keinen Platz hat.
Die Spitze dieses Systems bildet der Oberste Protektor, ein Titel, der nach dem Tod des Amtsinhabers durch die zehn Seneschalls – die obersten Generäle – neu vergeben wird. Da Einigkeit unter diesen taktikerprobten Köpfen selten ist, kommt es häufig zur „Tjost“: ein sechsmonatiger Initiationszug, auf den sich jeder Fehburger begeben kann, um seine Taten und Tapferkeit unter Beweis zu stellen. Nach diesen sechs Monaten kehren die Teilnehmer zurück, legen ihre Beweise für Heldentaten, Erkundungen und besiegte Feinde vor, und das Volk stimmt darüber ab, wer würdig ist, Protektor oder Protektorin zu werden. (Rolle der Tjoste in Fehburg)
Aktuell regiert Protektorin Marjena von Dornklinge, eine schweigsame, eher pragmatische Kriegerin, deren strategisches Geschick und persönliche Kampfkunst sie auszeichnet. Sie hat sich den Respekt sowohl der Seneschalls als auch der einfachen Speerträger erarbeitet.
Kampfkraft und Dienstleistung:
Ein einziger Krieger aus Fehburg soll so viel kosten wie ein ganzes Bataillon einer durchschnittlichen Armee, heißt es. Und das ist nicht nur Prahlerei: Jene, die Fehburg-Kämpfer anheuern, bestätigen, dass ein einzelner dieser Elitekrieger zwei feindliche Bataillone auszulöschen vermag. Taktisch geschult, in Perfektion trainiert, von Kindesbeinen an in den Kriegskünsten unterwiesen, verstehen die Fehburger den Kampf als höchste Kunstform.
Sie vermieten ihre Dienste nur selten und an sorgfältig ausgewählte Auftraggeber. Wer es sich leisten kann, einen Fehburg-Söldner zu verpflichten, erhält nicht bloß brutale Gewalt, sondern chirurgische Präzision. Diese seltenen Kämpfer operieren nach ihren eigenen Ehrenregeln, brechen kaum einmal einen Vertrag, aber verweigern auch Aufträge, die ihnen zu schändlich oder sinnlos erscheinen. Zwischen Ehre und Gewinn ist die Balance straff gespannt, doch die Reputation der Fehburger als Makel- und Unbesiegbare ist ihr höchstes Gut.
Kein besiegter Feind und uneinnehmbar:
Fehburg wurde im Laufe der Geschichte mehrfach angegriffen. Ambitionierte Herrscher, die sich rühmten, diese Festung zu bezwingen, mussten ihren Hochmut teuer bezahlen. Die Verteidigungslinien sind so konzipiert, dass selbst gigantische Heere mit fortschrittlichster Belagerungstechnik scheiterten. Tunnel unter der Burg sind mit Fallen gespickt, Außenmauern glitschig und hoch, die wenigen Zugänge von todbringenden Schützennestern gedeckt. Zudem wartet innerhalb der Mauern eine Elite, die jeden Feind bereits in der Planung zu durchschauen scheint.
Dass diese Festung bis heute nie nennenswert beschädigt wurde, verleiht Fehburg einen Nimbus der Unantastbarkeit, der andere Völker einschüchtert. Man erzählt sich, selbst Drachen oder Golems hätten hier keine Chance, da die Fehburger Taktiken finden, um jede Schwachstelle zu nutzen.
Wirtschaft und Handel:
Fehburg ist kein klassisches Handelszentrum. Es tauscht eher selten Güter aus, sondern erhält, was es braucht, meist als Bezahlung für seine Söldnerdienste. Gelegentlich lassen Herrscher, die auf den Schutz oder den Schlag einer Fehburg-Einheit hoffen, seltene Metalle, magische Essenzen oder technologische Wunder liefern, um das Wohlwollen aufrechtzuerhalten. So verfügen die Fehburger über ein Arsenal an außergewöhnlicher Ausrüstung, die sie nach eigenen Bedürfnissen weiterentwickeln.
Es ist weniger der Handel, der Fehburg gedeihen lässt, als die hohe Kunst, Bedürfnisse gering zu halten und alles aus den kargen Böden und Meereserträgen herauszuholen. Mit den Ressourcen, die sie erhalten, bauen sie ihre Verteidigungen aus, pflegen Waffen, ernähren ihre Gemeinschaft und verbessern ihre Trainingsanlagen. Ein steter Fluss von Gütern ist nicht nötig – Fehburg kann lange autark überdauern.
Glaubensvorstellungen und Ehrenkodex:
Die Fehburger folgen keinem ausgefeilten Pantheon, doch sie ehren die Tugenden des Krieges: Mut, Ehrlichkeit unter Waffenbrüdern, Respekt vor dem ebenbürtigen Gegner, Verlässlichkeit in der Schlacht. Einige Familienpfade und Kriegerlinien halten bescheidene Ahnenverehrung in Ehren, andere beten zu unpersönlichen Kriegsaspekten. Tiefe Religiösität ist selten. Stattdessen gilt ihr Hauptglaube den Regeln des Kampfes und der Gemeinschaft.
Wer sich gegen diese ethischen Richtlinien stellt, etwa Feigheit zeigt oder Verrat begeht, wird ohne Zögern aus der Gemeinschaft verbannt – ein Schicksal schlimmer als der Tod, denn außerhalb der Festung gibt es für einen Fehburger kaum einen Platz, an dem er Fuß fassen könnte.
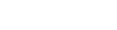



Comments