PRLG
Das Presse-, Rundfunk- und Lichtspielgesetz regelt in Österreich seit 1955 die Medienfreiheit. Es wurde auf Wunsch der Besatzungsmächte Frankreich, Union der Sozialistischen Sowjetrepubliken und Vereinigtes Königreich abgefasst und als erstes Gesetz nach der Unabhängigkeit am 16. Mai 1955 zügigst beschlossen und noch am selben Tag veröffentlicht.
Zweck
Historical Details
Hintergrund
Geschichte
Das Ziel der Besatzungsmächte lag darin, trotz des eigenen homogenen französischen, britischen oder sowjetischen Weltbilds in Österreich eine maximale Pluralität zu generieren, die ein militärisch-wirtschaftliches Erstarken von Anfang an durch Diversifizierung bremsen sollte.
Die Verpflichtung auf tägliche Nachrichten in den drei Besatzungssprachen (und wöchentlich auch auf Japanisch und Osmanisch) sollte die neue Souveränität des Staates von Anfang an in die neue Pentarchie (Fünferherrschaft der Großmächte) einordnen.
Öffentliche Reaktion
In Österreich wurden die mehrsprachigen Programme eher gelassen aufgenommen, kannte man doch die fremdsprachigen Nachrichten in der jeweiligen Besatzungssprache ja nun schon seit zehn Jahren. Besonders die nicht-deutschsprachigen Österreicherinnen freuten sich über die Nachrichten und Sendungen in ihren Sprachen.
In manchem war eher unklar, was 'österreichische Musik' sein sollte (in Österreich komponiert, musiziert, gesungen, aufgenommen...).
Eine sehr sublime Form des Widerstandes gegen dieses Gesetz ist die sehr häufige Füllung der japanische Sendezeit mit Origami- und Ikebanaanleitungen oder der französischen Zeiten mit langen Lesungen von Moliere oder Racinne, die dann jeweils mit einer kurzen Entgegnung der derzeitigen französischen Politik konterkariert werden. Britische Kochrezepte und sowjetische Nutzpflanzenbeschreibungen werden ebenfalls häufiger als politische Neuigkeiten aus jenen Staaten gedruckt und gesendet. Nicht zuletzt der osmanische Nachrichtenteil wird oft mit erotisierenden Geschichten von Tausendundeinernacht angereichert, um orientalistische Vorurteile zu untermauern und die Sittenwächterinnen auszutricksen.
Vermächtnis
Eine besondere Wirkung hatten vor allem zwei Vorschriften:
- Das Mehrsprachigkeitsgebot
Die Verwendung von Englisch, Französisch und Russisch bei den täglichen Nachrichtensendungen legte es geradezu nahe, dass in allen mittleren und höheren Schulen eine dieser drei Sprachen als lebende Fremdsprache erlernt werden musste, wobei oft die Geographie prägend war: Im Westen eher Französisch, im Süden eher Englisch und im Osten eher Russisch.
Obwohl als zweite lebende Fremdsprache, wo diese vorgesehen war, immer auch eine zweite Besatzungssprache möglich war, wurde doch vielfach eher eine der gesetzlich anerkannten Minderheitensprachen gewählt (Italienisch, Polnisch, Rumänisch, Slowakisch, Slowenisch, Ungarisch und Ukrainisch). Besonders oft wurden Kombinationen Italienisch-Französisch oder Ukrainisch-Russisch gewählt, um Lernaufwände zu minimieren.
Nur in den Landeshauptstädten wurde an höheren Schulen auch Japanisch und Osmanisch unterrichtet, dabei dann auch direkt auf das Zeitungs- und Rundfunkangebot als Lernmaterial zurückgegriffen.
- Das Restaurantbindungsgebot
Komplexer war die strikte Bindung von Lichtspiellizenzen an den Betrieb eines entsprechenden Restaurants: Während traditionelle österreichische Küche (inklusive der italienischen, polnischen, rumänischen, slowakischen, slowenischen, ungarischen und ukrainischen) mit jeder Art von Film kombiniert werden konnte, sprossen überall dort, wo britische, französische, japanische, osmanische oder sowjetische Filme gern gesehen wurden die gleichartigen Restaurants aus dem Boden. Die direkte Bindung des Filmverleihs an die jeweilige Botschaft schien manchen überkritischen Geistern als Einfallstür für die je befürchtete Propaganda der Gegenseite: Etwa britische Filme für die Monarchisten, französische Filme für die Atheisten, japanische Filme für die Technokraten, osmanische Filme für die Islamisierung und sowjetische Filme für die Kollektivierung. Faktisch trug diese Vorschrift eher zur Verbreiterung des gastronomischen Angebots bei und führte zu Einkünften selbst in britischen und sowjetischen Restaurants, die eher wegen der Filme als wegen der Speisen aufgesucht wurden.
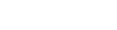



Kommentare