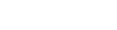Fjellheimar
Volk der Donnernden Berge
Herkunft und Lebensraum
Die Fjellheimar sind ein Volk, das in den Donnernden Bergen im Norden Frideyjas lebt – einer Region, die von kargen Gipfeln, tosenden Stürmen und tief eingeschnittenen Tälern geprägt ist. Für andere Völker wirken diese Berge unbewohnbar: Lawinen stürzen regelmäßig zu Tal, Steinschläge blockieren ganze Wege, und Stürme fegen unvorhersehbar über die Kämme. Doch für die Fjellheimar sind diese Gewalten nicht Bedrohung, sondern Heimat. Sie sagen: „Seltana atmet hier“, und damit meinen sie die Göttin des Rhythmus, die in jedem Donnerhall, jedem Sturmstoß und jeder Erschütterung der Erde gegenwärtig ist.
Die Siedlungen der Fjellheimar schmiegen sich eng an die Felswände, geschützt durch dicke Steinmauern und Holzbalken, die Wind und Schnee abhalten. Anders als die Nyjafólk im Süden oder die Samfólk in den Tälern kennen die Fjellheimar keine üppigen Böden, auf denen sie große Felder bestellen könnten. Stattdessen leben sie von kleinen Bergterrassen, Viehzucht, Jagd und dem, was die karge Flora der Höhenlagen hergibt. Ihre Anpassungsfähigkeit ist beeindruckend: Sie nutzen die Hänge für Ziegen- und Schafherden, sammeln essbare Moose, und jagen Schneehirsche, die nur in den höchsten Lagen leben. Für die Fjellheimar ist das Gebirge kein Hindernis, sondern eine Lehrmeisterin – unerbittlich, aber gerecht.
Die Donnernden Berge haben auch eine spirituelle Dimension. Lawinen gelten nicht als Katastrophe, sondern als „Seltanas Schritt“, ein Zeichen, dass sich etwas im Gleichgewicht der Natur verschoben hat. Das grollende Echo der Schluchten wird als ihre Stimme gedeutet, und jeder Blitz, der in den Gipfeln einschlägt, gilt als Schlag ihres rhythmischen Herzens. Für die Fjellheimar ist ihre Heimat also mehr als nur ein Lebensraum: Sie ist ein Tempel, in dem Seltana selbst wohnt und spricht.
Natur und Wahrnehmung
Die Fjellheimar haben eine Wahrnehmung entwickelt, die auf feine Zeichen achtet, weil das Überleben in den Bergen von Aufmerksamkeit abhängt. Sie deuten Wolkenzüge, Schneemuster und den Klang des Windes mit einer Präzision, die Außenstehenden übernatürlich erscheint. Doch während andere Völker diese Fähigkeiten als mystisch bezeichnen, verstehen die Fjellheimar sie als schlichte Notwendigkeit. Wer die Berge nicht „liest“, wird von ihnen verschlungen.
In ihrer Deutung der Naturkräfte steht Seltana im Mittelpunkt. Während Gardnar als ferne, ordnende Macht gilt und Eldhara als Sonne des Lebens verehrt wird, ist Seltana die Göttin, die unmittelbar wirkt. Sie ist der Rhythmus, der Regen bringt und wieder nimmt, der Sturm, der den Himmel reinigt, und die Kraft, die Fels in Bewegung setzt. Die Fjellheimar glauben, dass man nicht gegen diese Rhythmen leben darf – man muss sie spüren und sich einfügen. „Wer Seltana trotzt, trotzt seinem eigenen Herzschlag“, sagen sie.
Ein besonderes Beispiel für diese Wahrnehmung sind die „Sangesklippen“ – schmale Felsvorsprünge, die bei starkem Wind zu heulen beginnen. Die Fjellheimar gehen dorthin, um Rat zu suchen, denn sie glauben, dass in diesen Klängen Seltanas Wille liegt. Auch die Winde, die durch die Schluchten fegen, werden als Boten gedeutet: Ein plötzlicher Sturm kann als Warnung verstanden werden, ein überraschendes Aufklaren als Einladung, weiterzugehen. So ist das alltägliche Leben immer eng verwoben mit der Auslegung von Zeichen.
Kultur und Glaube
Die Fjellheimar verehren das gesamte Pantheon, doch ihre Religion hat eine klare Besonderheit: Seltana ist ihre Hauptgöttin. Während Eldhara im Skarnbund als höchste Göttin gilt und Gardnar im Glauben der Nordländer das kosmische Gleichgewicht symbolisiert, spüren die Fjellheimar vor allem Seltana als unmittelbare Gegenwart. Für sie ist sie nicht nur eine Naturkraft, sondern die Göttin, die ihren Alltag bestimmt – Herrin der Stürme, Bewahrerin der Rhythmen, Tänzerin der Elemente.
Ihre Mythologie erzählt, dass Seltana einst als Sturm über die Berge zog und die Fjellheimar an diesen Ort führte. Sie zeigte ihnen, wie man Schutz findet in Felsspalten, wie man den Rhythmus der Natur spürt, und wie man nicht durch Stärke, sondern durch Anpassung überlebt. Seitdem gilt sie als Lehrmeisterin und Beschützerin zugleich. Andere Götter sind nicht vergessen – Hrimnir steht für die Stille des Winters, Eldhara für das Licht des Sommers, Gardnar für das Gleichgewicht, das alles verbindet –, doch Seltana ist diejenige, zu der man am häufigsten spricht.
Rituale zu Ehren Seltanas sind zentral im Jahreslauf. Bei jedem großen Sturm wird ein „Donnerfest“ gefeiert, bei dem die Fjellheimar Trommeln schlagen, Hörner blasen und in rhythmischen Bewegungen tanzen, um den Takt der Göttin nachzuahmen. Auch persönliche Übergänge – Geburt, Erwachsenwerden, Hochzeit – sind mit Sturmritualen verbunden: Das erste Atmen eines Kindes wird als „Seltanas Hauch“ gefeiert, und beim Tod begleitet ein Blasen des Horns den Geist in die Berge, wo er sich dem Rhythmus der Göttin anschließt. So ist Seltana nicht nur Naturkraft, sondern auch Begleiterin durch alle Stationen des Lebens.
Gemeinschaft und Sozialstruktur
Die Fjellheimar leben in kleinen Gemeinschaften, die sie „Kreise“ nennen. Jeder Kreis umfasst ein Dorf oder eine Siedlung, meist nicht mehr als hundert Menschen, die eng zusammenleben. Entscheidungen werden im „Rat des Echos“ getroffen – ein Kreis von Stimmen, in dem alle Erwachsenen mitreden dürfen. Dabei geht es nicht um hitzige Debatten, sondern um das Abwägen, bis sich ein gemeinsamer Rhythmus ergibt. Man sagt, dass der Rat so lange tagt, bis „die Stimmen im Donner eins werden“. Das spiegelt die Nähe zu Seltana: Entscheidungen müssen im Einklang mit dem Rhythmus der Natur stehen.
Es gibt keine strengen Hierarchien, doch einige Rollen haben besonderes Gewicht. Die „Stimmen der Schlucht“ sind jene, die gelernt haben, die Zeichen der Berge besonders gut zu deuten, und sie haben in spirituellen Fragen Autorität. Die „Steinführer“ organisieren praktische Aufgaben wie den Bau von Mauern, die Sicherung von Wegen oder die Führung von Herden. Und die „Sturmtänzer“ leiten Rituale, bei denen die Gemeinschaft gemeinsam den Rhythmus der Göttin erfährt. Doch keine dieser Rollen ist erblich – jeder kann sie übernehmen, wenn er das Vertrauen der Gemeinschaft gewinnt.
Ein zentrales Element der Fjellheimar ist Solidarität. Das Leben in den Bergen ist so hart, dass niemand allein überleben könnte. Darum gilt die Regel: Wer Hilfe verweigert, wenn er sie geben könnte, hat sich selbst gegen die Göttin gestellt. Solche Menschen werden nicht bestraft, aber sie verlieren Ansehen – und das ist in einer so engen Gemeinschaft eine härtere Strafe als jeder Bann. Umgekehrt wird Großzügigkeit hoch angesehen, denn sie spiegelt den Rhythmus des Gebens und Nehmens, den Seltana selbst verkörpert.
Lebensweise und Rituale
Das Leben der Fjellheimar ist karg, aber geordnet. Ihre Häuser bestehen aus Stein und Holz, oft halb in den Fels geschlagen, um Schutz vor Lawinen und Wind zu bieten. Dächer sind flach und schwer, mit Steinen beschwert, damit sie dem Sturm standhalten. Die Innenräume sind schlicht, aber praktisch: eine zentrale Feuerstelle, Regale aus Steinplatten, Felle zum Schlafen. Schmuck oder Verzierung sind selten, doch Trommeln, Hörner und Windspiele sind in fast jedem Haus zu finden, denn Musik gilt als direkter Ausdruck Seltanas.
Die Nahrung ist einfach: Käse, Milch und Fleisch von Ziegen und Schafen, Wurzelknollen und Moose, die in den höheren Lagen wachsen, sowie Trockenfleisch von Wildtieren. Besonders verehrt wird das „Sturmgetränk“, ein dickflüssiger Sud aus Kräutern und fermentierter Milch, der bei Ritualen getrunken wird. Man glaubt, dass es den Rhythmus der Göttin in den Körper bringt.
Die wichtigsten Rituale drehen sich um den Jahreslauf der Stürme. Der Frühling wird mit dem „Erstdonner“ begrüßt, bei dem Hörner von den Gipfeln geblasen werden, um Seltana für die kommende Saison um Schutz zu bitten. Im Sommer gibt es das „Fest der stillen Nächte“, das seltene Wetterphänomen klarer Bergnächte, die als Geschenk der Göttin gelten. Der Herbst wird mit einem „Trommelzug“ begangen, bei dem die Fjellheimar durch die Täler ziehen und mit rhythmischem Schlag die Geister des Winters rufen. Der Winter selbst ist eine Zeit der Einkehr, in der Geschichten erzählt und die Trommeln nur leise geschlagen werden, um Seltanas Herz in der Dunkelheit zu spüren.
Fjellheimar und andere Völker
Die Fjellheimar sind den Samfólk verwandt, doch sie unterscheiden sich deutlich von ihnen. Während die Samfólk stärker in den Tälern leben und mehr in den Skarnbund integriert sind, bleiben die Fjellheimar eigenständig und misstrauisch gegenüber äußeren Einflüssen. Mit den Nordländern teilen sie die Nähe zu Gardnar und die Idee des kosmischen Gleichgewichts, doch die Fjellheimar legen viel mehr Gewicht auf Seltana und ihre Stürme. Mit den Nyjafólk haben sie wenig Kontakt, außer über gelegentliche Handelswege, bei denen sie Käse, Felle und Steinwaren gegen Getreide oder Metall eintauschen.
Trotz ihrer Eigenständigkeit sehen die Fjellheimar sich nicht als Feinde anderer Völker. Sie respektieren, dass jedes Volk seinen eigenen Rhythmus hat, und glauben, dass Seltana es so gewollt hat. Doch sie lassen sich nicht vereinnahmen: Wer versucht, ihnen Gesetze oder Bräuche aufzuzwingen, stößt auf wortlosen Widerstand. So haben die Fjellheimar eine Haltung entwickelt, die weder Isolation noch Unterordnung kennt, sondern die feste Überzeugung, dass ihr Platz im Rhythmus der Welt einzigartig ist und bewahrt werden muss.