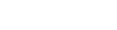Veynos Stormwake
Der Abgetauchte – ein Mann zwischen Flut und Flamme
Herkunft aus der Stille
Veynos wurde in den schimmernden Kuppeln von Arvassil geboren, jener abgelegenen Triton-Gemeinschaft tief unter dem Meeresspiegel, wo das Licht gedämpft flimmert und die Zeit in Strömungen gemessen wird. Dort zählt jedes Wort, jede Geste, jeder Schritt im Tanz der Tiefe. Die Ordnung war sein erster Lehrmeister – nicht durch Zwang, sondern durch das Vertrauen in eine uralte Harmonie.
Er war ein pflichtbewusstes Kind, neugierig im Rahmen der Traditionen, begabt im Lesen der Strömungen, still, aber nicht auffällig. Nichts an ihm deutete darauf hin, dass er einmal alles verlassen würde, was ihm vertraut war. Er stellte keine Fragen, die nicht gestellt werden durften. Er erfüllte seine Aufgaben, lauschte dem Wissen der Älteren, bereit, seinen Platz im Netz der Gemeinschaft einzunehmen.
Doch dann kam die Trance. Die rituelle Reise in die Atemlose Schwelle, ein Übergang, den alle durchlaufen – aber nicht alle mit demselben Blick zurückkehren. Veynos sah nicht die Gesichter der Ahnen, keine Zeichen aus den Tiefen. Er sah eine Stadt aus Rauch und Stimmen, aus Holz und Bewegung – über der Wasserlinie. Und in ihrem Herzen: eine Unruhe. Eine Leere, die ihn nicht erschreckte, sondern rief.
Als er erwachte, fühlte er etwas, das schwer zu benennen war. Keine Rebellion. Kein Bruch. Aber ein leiser Riss in der Sicherheit, mit der er bis dahin in seiner Welt gestanden hatte.
Er erzählte seiner Mutter von der Vision. Sie schwieg. Kein Tadel, kein Trost – nur dieses eine Schweigen, das ihn seitdem begleitet: ein stilles Urteil, das ihn nie verlassen hat.
Ein Leben am Rand der Flut
Veynos verließ Arvassil nicht im Zorn. Er ging, weil das, was er gesehen hatte, nicht verstummte. Wochen vergingen, dann Monde, in denen er sich bemühte, die Ordnung wiederzufinden – doch in jedem Muster erkannte er nun Lücken. In jeder Geste sah er Spiegelbilder einer Welt, die er noch nicht kannte. Irgendwann verstand er: Es war nicht die Tiefe, die ihn verstieß. Es war er selbst, der nicht mehr ganz in ihr verankert war.
In Njördskara, der wilden Stadt der Rowarkar, fand er das Bild seiner Vision – und doch war es anders. Es war lauter, rauer, unberechenbarer. Kein Kodex, keine Hierarchie, kein Tempel. Nur Geschichten, Zeichen und instinktives Miteinander.
Er wurde nicht abgewiesen. Die Rowarkar betrachteten ihn mit Neugier, manche mit Spott, viele mit Staunen – als wäre er ein verlorenes Zeichen aus einem Lied, das keiner ganz verstand. Und dann kam Yila. Sie sah ihn an, als wäre er längst da gewesen. Und sie küsste ihn, bevor er überhaupt den Namen ihrer Gasse wusste. „Du bist der schönste Fehler, den die See je gemacht hat“, sagte sie. Und zum ersten Mal lachte er.
Er lebt nun an der Kante von Njördskara – wo die Stege schwanken, wo das Holz knarrt und das Wasser spricht. Er beobachtet. Er hilft. Er mischt sich ein, wenn es nottut – aber meist schweigt er. Und doch spüren viele seine Gegenwart, als wäre er nicht nur Veynos, sondern etwas Tieferes, das durch ihn hindurch lauscht.
Die Fremde in ihm
Trotz seiner Herkunft aus der Tiefe trägt Veynos seltsame Eigenheiten in sich, die so gar nicht zu einem Kind des Meeres passen wollen. Er ist fasziniert vom Feuer – nicht aus Angst oder Ehrfurcht, sondern aus stiller Bewunderung. Wenn ein Lagerfeuer knistert, sitzt er oft stundenlang daneben und beobachtet die Flammen, als würde er darin Worte lesen, die nur er versteht. Er sammelt duftendes Holz und harzige Späne, bewahrt sie sorgfältig auf – doch zündet sie nur selten an. Das Feuer ist für ihn ein Rätsel, das sich nicht lösen lässt, aber das wärmt.
Eine zweite, fast kindliche Leidenschaft gilt den Vögeln – besonders den Möwen, Krähen und anderen gefiederten Landwesen, die in seiner Heimat schlicht nicht existieren. Er spricht mit ihnen, füttert sie, zeichnet sie heimlich auf kleine Pergamentfetzen. Unter seinem Bett liegt ein gebundenes Heft mit Skizzen: ein einbeiniger Kormoran, ein altes Möwenpaar auf einem Mast, eine Krähe, die ein Fischauge stiehlt. Wenn man ihn darauf anspricht, wechselt er verlegen das Thema. Es ist vielleicht das Einzige, wofür er sich schämt – und das Einzige, woran er ohne Zweck Freude findet.
Und als wäre das nicht genug, liebt er Rätsel. Zahlen, Muster, sprachliche Knoten. In langen Nächten überzieht er glatte Holzplatten mit eingeritzten Reihen, deren Ordnung nur er erkennt. Niemand weiß davon – nicht einmal Yila. Es ist ein stiller Widerhall seiner alten Welt: Struktur, die er nicht lebt, aber nicht ganz loslassen kann.
Der Wunsch nach Gleichgewicht
Wenn keine Aufgabe ruft, kein Sturm aufzieht, treibt ihn eine stille Sehnsucht an: die Hoffnung, ein Gleichgewicht zwischen den Welten zu finden – zwischen der stummen Tiefe, die ihn geprägt hat, und dem atmenden Chaos, das ihn verändert. Es ist kein Ziel, das sich greifen lässt, und kein Pfad, der sich kartieren ließe. Es ist ein inneres Strömen.
In den kleinen Momenten wird es sichtbar. Wenn er achtlos ein umgekipptes Gefäß wieder aufrichtet. Wenn er im Gespräch innehält, weil ein Satz nicht im Fluss liegt. Wenn er lieber schweigt, als ein Lachen zu unterbrechen. Seine Welt ist aus Wasser gebaut – aus Bewegung, Spiegelung und Tiefe.
Und doch ist da auch Angst. Nicht vor dem Versagen – sondern davor, das Falsche zu bewahren. Denn was, wenn das, was aus dem Gleichgewicht geraten ist, nicht geheilt werden will?
Prinzipien und Zweifel
Veynos lebt nach stillen, aber tief verankerten Grundsätzen. Er glaubt, dass jedes Wesen – gleich welcher Herkunft – ein Recht auf Würde und Schutz hat. Verletzlichkeit ist für ihn kein Makel, sondern ein Moment, in dem Verbindung möglich wird. Deshalb hilft er jenen, die übersehen werden, ohne Aufhebens, ohne Gegenleistung. Er trägt Verletzungen nicht nach, solange Reue möglich ist – aber vergisst nie, wer wann geschwiegen hat.
Seine moralische Stärke liegt in der Konsequenz des Leisen: Er bricht lieber ab, als sich zu verbiegen. Und doch ist seine Ethik keine starre Lehre – sondern ein tastendes Navigieren zwischen Mitgefühl und Klarheit. Er verabscheut Lügen, aber hat gelernt, dass nicht jede Wahrheit heilt. Wenn er schweigt, dann aus Verantwortung – nicht aus Flucht.
Doch was ihn auszeichnet, ist nicht nur, woran er glaubt, sondern wie sehr er an sich selbst zweifelt. Manchmal fragt er sich, ob sein Beharren auf Gleichgewicht nicht eine Flucht vor Veränderung ist. Ob seine Gnade gegenüber anderen ein Weg ist, das Urteil über sich selbst zu vermeiden. Wenn er nachts an Deck sitzt, über Njördskaras Lichter, die sich im Wasser brechen, fragt er sich, ob er der ist, für den ihn andere halten – oder ob er sich bloß bemüht, etwas zu sein, das sein altes Leben aus ihm gemacht hat.
Er kennt Kompromisse – und meidet sie, wo er kann. Aber wenn sie nötig sind, wägt er sie ab wie seltenes Salz: genau, zögernd, mit Wehmut.
Makel unter der Oberfläche
Trotz seiner Ruhe ist Veynos nicht unversehrt. Die Luft der Oberwelt bleibt ihm fremd – zu trocken, zu scharf, zu laut. An windstillen Tagen fällt ihm das Atmen schwer, als würde sein Körper sich an eine Dichte erinnern, die es hier nicht mehr gibt. Es ist mehr als ein physiologisches Unbehagen. Es ist ein Widerhall seines inneren Zustands: ein Wesen zwischen Druck und Leere, zwischen Tiefe und Oberfläche, ohne festen Anker.
In hitzigen Debatten oder lärmenden Straßen verstummt er oft – nicht aus Mangel an Worten, sondern weil seine Sprache Raum und Atem braucht. Worte sind für ihn Wellen, keine Schläge. Wenn sie zu eng werden, bricht der Fluss. Dann zieht er sich zurück, schweigend, horchend, flach atmend wie ein Fisch im fremden Wasser.
Doch seine größte Schwäche liegt tiefer. Er zweifelt. An sich, an seiner Entscheidung, Arvassil zu verlassen. Manchmal, in stillen Nächten, öffnet er die kleine Kiste unter seinem Bett. Darin liegt ein Brief – sorgsam gefaltet, auf dickem Papier, beschrieben mit ruhiger Hand. Es ist ein Geständnis an seine Mutter: keine Reue im Ton, aber Traurigkeit in jedem Satz.
Er hat ihn nie abgeschickt. Nicht aus Trotz. Sondern weil er nicht weiß, was schmerzlicher wäre: ihn zu senden – oder ihre Antwort zu erhalten. Vielleicht gibt es keine Antwort. Vielleicht war das Schweigen seiner Mutter in jener Nacht bereits alles, was es zu sagen gab.
Geteilte Strömungen
Yila, die ungestüme Zeichnerin, ist sein Gegenstück – laut, leichtfüßig, voller Feuer. Sie fordert ihn, bringt ihn zum Lachen, zwingt ihn ins Jetzt. Kapitän Korrum dagegen – ein alter Rowarkar mit zu vielen Geschichten und zu wenig Vertrauen – sieht in ihm ein Mahnmal. Beide bedeuten ihm mehr, als er je sagen würde.
Und dann ist da Asrell. Die Stimme aus der Tiefe, die in seinen Träumen spricht. Mal als Sturm, mal als Schweigen. Veynos weiß nicht, ob sie ihn führt oder warnt. Vielleicht ist das dasselbe.
Die Stimme der Tiefe
Veynos’ Sprache ist ruhig, voll weicher Bilder und leiser Rhythmen. Er redet nicht viel – aber wenn, dann oft in Sätzen, die hängenbleiben wie Salz auf der Haut. Seine Hände ruhen meist still, doch wenn er nachdenkt, streichen die Finger übereinander, als suchten sie Wasser. Und wenn er einen Ort betritt, geschieht das nicht mit Tritt und Schritt – sondern mit Präsenz, die kommt wie Flut: leise, umfassend, nicht zu leugnen.
Er träumt manchmal von einem anderen Leben. Ein einfaches Haus über dem Wasser, ein Garten aus Korallen, vielleicht ein Boot, das nie aufbricht. Ein Leben ohne Zeichen, ohne Aufgaben. Nur Atem und Wärme.
Doch dann hört er wieder das Rufen. Und er weiß: Die Tiefe ist nicht fertig mit ihm.
Spielweise: Wie Veynos dem Meer Gestalt verleiht
Veynos ist kein Zauberwirker, der mit Blitz und Dramatik das Schlachtfeld beherrscht. Seine Kraft wirkt wie das Meer selbst: stetig, umgebend, unaufhaltsam. Wenn er sich erhebt, verändert sich die Luft – die Feuchtigkeit kriecht in die Knochen, der Boden scheint nachzugeben, und jene, die ihm zu nahekommen, spüren den Druck der Tiefe. Er stößt Gegner nicht mit Gewalt zurück, sondern mit der kalten, weichen Wucht von Strömungen. Seine Magie formt Wasser, Nebel und Frost – sie hemmt, verschleiert, verlangsamt. Und wenn er sich über das Schlachtfeld erhebt, geschieht es nicht durch Flügel oder Befehl, sondern weil der Wind ihn trägt – weil er Teil des Wetters geworden ist. Abseits des Kampfes ist Veynos stiller Beistand: ein Heiler, ein Deuter, ein Beobachter, der das Gleichgewicht sucht, indem er es lebt. Wer ihn spielt, verkörpert das Wasser – nicht durch Kraft, sondern durch Tiefe.