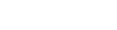Morûndiel
Morûndiel
Ursprung und himmlischer Pakt
Morûndiel war einst Licht. Als Deva wandelte er unter den Sterblichen, nicht aus Strafe gefallen, sondern aus freiem Willen herabgestiegen. Ein uraltes Versprechen hatte ihn gebunden – ein Pakt, geschlossen zwischen den Himmlischen und einer längst vergessenen Blutlinie, die das abgelegene Dorf schützte. Morûndiel wurde zum Hüter dieses Schwurs, und auch wenn er nicht allein war, zählte er zu den Jüngsten jener himmlischen Wesen, die die Grenzen zwischen Ordnung und drohender Dunkelheit bewachten. In diesem Dorf wurden nicht nur drei Splitter des Rheinlichts aufbewahrt, geformt von der Göttin Lía selbst, sondern auch andere, namenlose Artefakte von solcher Heiligkeit, dass Lía sie nicht selbst an sich nehmen konnte. Und so wurde ein Pakt geschlossen: Die Engel würden das Dorf bewachen, wenn es im Gegenzug als Aufbewahrungsort diente – verborgen vor den Blicken der Sterblichen wie der Götter.
Der Raub der Splitter
In einer einzigen Nacht wurden die drei Lichtsplitter gestohlen. Die Spur war deutlich: Gnome hatten sie entwendet, ob aus eigenem Antrieb oder im Auftrag anderer, blieb unklar. Andere heilige Gegenstände verschwanden ebenfalls, doch niemand wusste je, was sie wirklich waren. Die Götter schwiegen. Die Engel schwiegen. Morûndiel wurde entsandt, sie zurückzuholen, als Einziger, denn die anderen Wächter mussten das Dorf verteidigen. Doch er fand sie nicht. Es war, als hätten sich die Splitter vor ihm verborgen. Eine Macht, die er nicht verstand, entzog sie seinem Blick. Dieser Misserfolg quälte ihn. Und als er zurückkehrte, war es zu spät.
Das Erwachen des Bösen
Das Böse war nicht gekommen wie ein Sturm, sondern wie eine Krankheit. Erst unsichtbar, dann allumfassend. Es brachte Kreaturen hervor, die nicht mordeten, sondern deformierten. Entstellungen, die Leben in etwas Fremdes verwandelten. Mit ihnen kam der Pilz, ein erinnerndes Gewebe, das sich in die Risse der Welt legte. Als Morûndiel zurückkehrte, fand er das Dorf gefallen, seine himmlischen Geschwister zerbrochen, die Menschen verschwunden oder verwandelt. Der Pilz hatte begonnen, sich über die Ruinen zu legen. Und Morûndiel blieb allein zurück.
Der Fall des Dorfes
Die Monster, die das Dorf überrannten, waren bereits von Sporen durchdrungen. Sie waren das Ergebnis einer Verwerfung, einer arkane Erschütterung durch das erste Zünden des Großen Werks. Die Pilze hatten versucht, dem entgegenzuwirken. Nicht mit Gewalt, sondern mit Verfall. Morûndiel erkannte, dass sie keine Feinde waren. Und doch blieb ihm die Frage: Wer hatte sie ausgesandt? Was wollten sie bezwecken? Werkzeug, Wille oder Wesen? Er wusste es nicht.
Als Morûndiel zurückkehrte, fand er das Dorf gefallen, seine himmlischen Geschwister zerbrochen, die Menschen verschwunden oder verwandelt. Der Pilz hatte begonnen, sich über die Ruinen zu legen. Und Morûndiel blieb allein zurück.
Die Wendung
In seiner Verzweiflung kniete Morûndiel nieder, nicht zu den Himmeln, sondern zum Boden. Zum Myzel, das sich über Leiber legte. Es antwortete ihm. Nicht mit Trost, sondern mit Verbindung. In diesem Moment zerbrach etwas in ihm, sein Licht, sein himmlischer Kern. Und etwas Neues entstand. Schimmel durchdrang ihn, Erinnerungen füllten ihn, Schmerz wurde Teil seines Wesens. Er verstand: Die Pilze waren keine Seuche. Sie waren eine Reaktion.
Die Verbindung
Zuerst wehrte er sich – gegen das Flüstern, gegen das Eindringen, gegen das Aufgeben. Doch das Myzel fragte nicht. Es war da, durchdrang ihn mit Sporen und Bildern, mit Erinnerungen, die nicht seine waren. Es nahm ihn nicht mit Gewalt – es lud ihn ein. Und Morûndiel, zerbrochen und allein, nahm an. Die Veränderung war nicht augenblicklich. Sie kroch durch ihn, langsam. Sein himmlisches Licht erlosch wie eine verglühende Sternschnuppe. Was blieb, war eine neue Form von Leben. Seine linke Schwinge verfaulte zuerst, wurde durchzogen von einem dichten Geflecht aus Pilzfäden, das sich wie Rauch unter der Haut ausbreitete. Die rechte blieb – doch taub, kraftlos, ein Relikt. Seine Haut wurde glasig, porös, durchwirkt von Adern aus Myzel, das in schwachem Grün und Braun pulsierte. Sein Blick veränderte sich: Wo einst strahlende Gewissheit lag, glimmte nun eine tiefe, erdige Erkenntnis. Er wurde nicht zu einem Monster, sondern zu etwas Drittem. Zwischen Licht und Fäulnis. Kein Engel mehr – aber auch kein Sterblicher.
Morûndiels Veränderung
Seit jener Zeit ist Morûndiel nicht mehr, was er war. Ein Flügel ist nur noch ein morscher Stumpf, der andere ein lebloses Relikt. Seine Haut ist glasig, durchzogen von Pilzfäden. In seinen Augen liegt Erkenntnis, kein Wahnsinn. Er riecht nach Erde, Regen und verrottetem Holz. Seine Gegenwart ist ein Echo von Verfall und Neubeginn. Der Stab des lebenden Bodens, gekrönt von der Myzelkrone Myrthwyn, begleitet ihn. Eine lebendige Symbiose aus Erinnerung und Wahrheit.
Zustand und Kräfte
Er heilt, indem er zerfallen lässt. Er erinnert, indem er berührt. In seinem Leib wuchert das Myzel, flüstert, lehrt, erinnert. Aus den Toten liest er Fragmente, aus dem Boden zieht er Wahrheit. Sein Körper zerfällt und erneuert sich in einem endlosen Zyklus.
Doch auch im Kampf hat sich Morûndiel gewandelt. Wo einst strahlende Klingen führten, wachsen nun Sporenwellen aus seiner Haut, die Gegner schwächen und das Gleichgewicht stören. Er ruft aus dem Boden faulende Wucherungen empor, Pilzgeflechte, die angreifen, festhalten oder zersetzen. Um ihn herum bildet sich eine unsichtbare Aura aus Sporen, die alles Leben beeinflusst – nicht feindlich, sondern transformierend. In Momenten höchster Konzentration lässt er neue Formen aus abgestorbenem Fleisch entstehen: Pilzartige Schatten, die ihm folgen, kämpfen, oder Erinnerungen aussprechen, die längst vergessen waren.
Er wirkt nicht durch Gewalt, sondern durch Einfluss. Er schwächt nicht nur Körper, sondern stört Bindungen, zersetzt Gewissheiten. Selbst seine Gegenwart verändert die Umwelt: Holz fault schneller, Moos breitet sich aus, das Lebendige beginnt zu flüstern. Und dennoch liegt in ihm keine Bosheit – sondern das unausweichliche Echo eines neuen Zyklus.
Nýrla – Die Wahrheit im Zerfall
In seinen tiefsten Momenten begegnet er Nýrla. Kein Licht, keine Erhebung. Nur eine Ahnung aus Sporen, verborgen im Boden. Sie ist keine Gottheit im klassischen Sinne. Sie verlangt keine Gebete. Doch sie existiert. In allem, was stirbt. In allem, was vergeht. Sie spricht, wenn Hoffnung zur Lüge wird. Wenn Ordnung versagt. Ihre Wahrheit ist nicht Trost, sondern Erkenntnis im Verfall.
Wachsende Macht
Mit jedem Schritt auf seinem neuen Pfad wächst Morûndiels Verbindung zu Nýrla. Ihre Stimme wird klarer, ihr Einfluss tiefer. Er spürt, wie sich in bestimmten Momenten etwas in ihm regt – als würde die Erde selbst ihm mehr gewähren. Neue Sporenformen erscheinen in seinen Träumen, wachsen unter seiner Haut, bis sie sich schließlich auch in der Welt zeigen. Mit jeder Offenbarung verändert sich sein Innerstes. Als er begann, Wesen aus Verfall zu formen, war es nicht plötzlich – er hatte es Wochen vorher gespürt, wie eine gärende Möglichkeit, die in seinem Fleisch reifte. Es war Nýrla, die ihm dies gab, und es war sein Wandel, der es ermöglichte.
Die Stufen seines Wachstums verlaufen nicht linear. Manche Gaben kommen mit Schmerz, andere mit Erkenntnis. Als seine Verbindung zur Pilzmatrix reifte, wurde ihm ein tieferes Verständnis für das Netz des Todes zuteil – und mit ihm die Fähigkeit, verfallene Körper zu neuem Zweck zu rufen. Diese Schatten, durchdrungen von Sporen, sind keine Untoten, sondern Fragmente alter Wahrheit, zusammengehalten durch sein Willen und durch Nýrla selbst. In jedem neuen Zyklus, in jeder Vertiefung seiner Kräfte, spürt Morûndiel, dass er nicht nur wächst – er wird. Nicht zu einem Wesen der Macht, sondern zu einem Gefäß für eine größere Wahrheit.
Die neue Rolle
Morûndiel weiß nicht, ob er auserwählt wurde. Doch er spürt, dass Nýrla durch ihn spricht. Seine Wahrheit unterscheidet sich von der Hoffnung, die er einst in Lýr sah. Vielleicht war es diese Hoffnung, die die Welt verletzlich machte. Vielleicht war er einst nur eine Marionette. Jetzt sucht er Selbsterkenntnis. Er will verstehen, warum die Gnome die Splitter stahlen, was sie mit dem Großen Werk zu tun haben, warum er sie nicht fand, warum die Verteidigung scheiterte. Und warum er überlebte. Er weiß nicht, wer heute im Besitz der Artefakte ist. Gnome, Menschen, Engel? Es bleibt offen. Doch mit jeder Erkenntnis wächst sein Verständnis – und mit ihm sein Zweifel an jener Hoffnung, die ihn einst trug.
Epilog
Vielleicht ist all dies nicht das Ende. Vielleicht ist es der Beginn von etwas Neuem. Einer Erkenntnis, die keine Erhöhung verlangt. Einem Wandel, der keinen Krieg braucht. Einer Wahrheit, die ohne Ruhm auskommt. Morûndiel ist verfallen, doch verbunden. Und inmitten seines Zerfalls trägt er die Hoffnung, dass aus allem, was stirbt, etwas wächst, das wirklich lebt.

Myrthwyn (später)
In den Ruinen eines versunkenen Hains, wo selbst die Luft nach Moder flüsterte, fand Morûndiel das wabernde Gewebe – nicht tot, nicht lebendig, sondern wartend. Es klammerte sich an einen abgebrochenen Ast, der längst kein Leben mehr trug, und doch schien es ihn zu nähren. Die Wesen der Tiefe nannten es Myrthwyn, ein uraltes Gewächs der namenlosen Göttin, die nicht angebetet wird, sondern in den stillen Umbrüchen der Welt wirkt. Myrthwyn windet sich in schleimigen, glasig schimmernden Schichten um das obere Ende seines Stabs, wächst langsam, reagiert auf Gedanken, Erinnerungen – und Verfall. Wenn Morûndiel sich mit dem Boden verbindet, flüstert es in seinen Träumen: keine Worte, sondern Bilder aus längst gestorbenen Augen. Es heilt, indem es nimmt, und zeigt, indem es verdirbt – ein Zeuge dessen, was einst war, und ein Spiegel dessen, was verborgen liegt.
Nýrla
Nýrla ist keine Göttin im strahlenden Sinne. Sie erscheint nicht in Visionen aus Gold, ruft keine Gläubigen zu Tempeln und schenkt keine Siege. Ihre Gegenwart ist älter als jedes Gebet – sie ruht in der Dunkelheit unter dem Moos, im Atmen des Bodens nach dem Regen, im langsamen Gedächtnis der Dinge. Nicht der Zerfall ist ihr Zweck, sondern das Wiedererinnern der Welt an sich selbst, jenseits aller Götter.
Denn während andere Götter für das Licht, den Krieg, das Schicksal oder die Hoffnung stehen, gehört Nýrla allein der tiefen Bindung zwischen Substanz und Wahrheit. Sie ist das uralte Flüstern im Humus, das Wissen, das entsteht, wenn niemand hinsieht. In ihr sammelt sich das Gedächtnis jener, die nicht gehört wurden – nicht als Seelen, sondern als Formen: das Gewicht alter Knochen, das Wispern von Myzel unter Bäumen, der Abdruck verlorener Leben in verwittertem Stein.
Ihr Wissen ist kein göttliches Geschenk, sondern ein langsames Destillat aus Erfahrung, Vergehen und Wandlung. Wo andere Götter den Himmel durchdringen, sickert Nýrla in das Mark der Welt. Und was sie weiß, ist etwas, das kein himmlisches Wesen je begreifen könnte: wie es ist, wenn die Welt sich selbst vergisst – und wie sie sich durch das Wachsen im Verfall wieder an sich erinnert.
Manche nennen sie die Schwellenmutter, denn sie erscheint immer dort, wo etwas nicht mehr das ist, was es einmal war, aber auch noch nicht, was es werden könnte. Andere nennen sie die, die im Innern der Dinge liegt – nicht, weil sie sich versteckt, sondern weil man sie nur sieht, wenn man lange genug bleibt.
Ihre Verbindung zur Erde ist nicht metaphorisch. Sie ist tatsächlich Teil des Gewebes – keine Göttin über der Welt, sondern ein Bewusstsein in ihr. Aus diesem Grund kann sie Dinge wahrnehmen, die anderen Göttern verschlossen bleiben: nicht weil sie allmächtig ist, sondern weil sie allgegenwärtig im Irdischen ist. Wenn ein Körper zerfällt, wenn eine Wurzel bricht, wenn ein Zahn sich in Sediment verwandelt – sie erinnert sich. Und aus dieser Erinnerung zieht sie jene Art von Wahrheit, die nicht in Worten, sondern in Gestalt wohnt.
Darum kommen ihre Prophezeiungen nicht als Befehl oder Drohung, sondern als Bild, als Traum, als Veränderung. Und wer von ihr berührt wird, wie Morûndiel, der trägt keine göttliche Auserwählung – sondern eine Verantwortung: nicht für das, was war, sondern für das, was sich aus dem Vergangenen formen lässt.