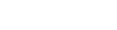Fenwyn Va’calor
Fenwyn Va'calor
Herkunft und verlorene Wurzeln
Niemand wusste, woher der Junge kam, als er eines späten Herbstabends am Rand des Klosters Calven Ora stand – schweigsam, schmal, mit einem Blick, der älter wirkte als sein Körper. Er sagte wenig, nannte einen Namen, den niemand kannte, und trug ein Gesicht, das niemand erkannte. In Wahrheit war es nicht sein eigenes. Fenwyn war ein Changeling, ein Wesen ohne festes Selbst – und das Gesicht, das er trug, war das eines sterbenden Mannes, dessen letztes Aufbäumen er heimlich beobachtet hatte. Der Name „Fenwyn“ war aus einem Gefühl geboren, nicht aus Herkunft.
Das Dorf Kellbrunn, das zum Kloster gehörte, nahm ihn auf. Man gewöhnte sich an den stillen Jungen mit den braunen, leicht gelockten Haaren, den Sommersprossen, dem schmalen Gesicht. Seine mittlere Größe und schlanke Gestalt ließen ihn unauffällig wirken – und doch schien er in jedem Raum irgendwie fehl am Platz. Als hätte er einen Schatten dabei, den niemand sehen konnte.
So wurde aus dem namenlosen Jungen Fenwyn Va’calor – der Fremde von Calven Ora, ohne Herkunft, aber mit einem Ort, der ihn prägte. Sein Name war nicht Erbe, sondern Entscheidung – ein stilles Bekenntnis zu dem einzigen Zuhause, das er je kannte.
Ein stilles Leben hinter Mauern
Die ersten Jahre im Kloster waren ruhig. Fenwyn lernte, wie man Kräuter trocknet, einfache Eintöpfe zubereitet, Wunden wäscht und still sitzt, wenn Gebete gesprochen werden. Er sprach selten, doch wenn er es tat, mit ruhiger, klarer Stimme – ohne Zierrat, ohne Lüge. Seine Hände waren geschickt, seine Ohren aufmerksam. Es war kein Leben voller Glück – aber es war ein Leben mit Struktur, und das genügte ihm.
Rund um Dorf und Kloster standen die Halvenbäume – ausgehöhlte, alte Stämme, in deren Innerem das Halvenlicht brannte. Diese goldene Essenz, erschaffen von alchemistischen Mönchen, verband sich in Linien aus Licht zwischen den Bäumen. So entstand eine Barriere gegen die Untoten – ein feines, flimmerndes Band, das auch am Tag wirkte, wenn auch kaum sichtbar. Die Schutzlinie war nicht magisch im klassischen Sinne – sie war eine alchemistische Erkenntnis, weitergegeben, gewartet, gehütet wie ein heiliger Schatz.
Bis eines Nachts ein Baum fiel. Und mit ihm – die Ordnung.
Verlust und Schwur
Der erste Angriff traf Kellbrunn wie ein kalter Strom. Die Untoten kamen nicht als Welle, sondern als Rinnsal, das durch eine Lücke kroch, sich sammelte, zersetzte. Viele starben. Die Überlebenden flohen ins Kloster, das selbst zu einer letzten Bastion wurde. Fenwyn war kein Kämpfer – noch nicht. Doch er lernte. Er musste.
Er trainierte mit Schwert und Axt, flickte Rüstungen, schleppte Wasser, hielt Wache. In den Jahren der Belagerung schwand der Glaube, aber der Wille blieb. Als das Kloster schließlich fiel, überlebte Fenwyn – wieder einmal. Doch dieses Mal blieb nichts zurück, was ihm Halt gab. Niemand, der ihn kannte. Niemand, der ihn wollte. Nur Urthelbann – das alte Großschwert aus schwarzem Stahl, das ihm der sterbende Ordensmeister übergab, mit den Worten:
„Vergiss uns nicht. Und wenn du es vergisst – vergiss nicht, warum du kämpfen musst.“
In dieser Nacht sprach Fenwyn keine Gelübde. Doch in seinem Innersten formte sich etwas – ein Eid, geboren nicht aus Zorn, sondern aus Notwendigkeit: die Entscheidung, gegen jene zu kämpfen, die anderen ihre Geschichte rauben. Er hatte nie eine eigene – aber das Kloster hatte ihm eine gegeben. Und diese Schuld trug er nun in der Klinge.
Körper, Stimme, Verhalten
Fenwyn bewegt sich kontrolliert, fast zu bedacht. Seine Haltung ist aufrecht, doch nie stolz. Er ist muskulös durch das jahrelange Training, aber nicht massiv – eher drahtig, mit der Präzision eines Überlebenden. In Stressmomenten senkt er leicht die Schultern, vermeidet Blickkontakt, atmet langsam. Sein Blick hat etwas Trauriges, aber zugleich einen Hoffnungsschimmer – wie jemand, der nicht weiß, ob er schon gefallen ist oder noch fällt.
Seine Sprache ist sparsam. Er redet wenig, und wenn, dann sachlich. In vertrauten Momenten zeigt er einen trockenen Humor, beinahe sanft. In Bedrängnis wird seine Stimme rauer, kürzer – nie laut. Beim Lügen wird er still. Bei der Wahrheit ruhig.
Stärken und Schwächen
Fenwyn besitzt eine stille Standhaftigkeit. Er bricht nicht – nicht vor Schmerz, nicht vor Angst. Seine größte Stärke ist sein Durchhaltewille, seine Fähigkeit, selbst im Chaos Ordnung zu finden. Er ist einfühlsam, aber nicht naiv, diszipliniert ohne Härte. Und er hat ein feines Gespür für Menschen – wer lügt, wer leidet, wer etwas verbirgt.
Doch er trägt auch Schatten in sich. Er weiß nicht, wer er ist – und diese Leere verfolgt ihn wie ein zweites Herz. Er fragt sich, wer der Mann war, dessen Gesicht er trägt. Manchmal träumt er davon, dass dieses Gesicht ihn anklagt – stumm, unerbittlich. Er leidet an Schuldgefühlen, nicht nur wegen der Verluste, sondern weil er überlebte. In Gruppen fühlt er sich fremd, antwortet ausweichend, meidet Gespräche über sich selbst. Und wenn er Ungerechtigkeit sieht – echte, rohe Grausamkeit – brennt in ihm ein unkontrollierbarer Impuls, ein Wille zur Vergeltung, der alles andere ausblendet.
Träume und Interessen
Fenwyn träumt nicht von Ruhm. Sein Wunsch ist schlicht: ein Haus mit Holzfeuer, ein Tisch, an dem niemand stirbt. Er interessiert sich für alte Geschichten, für einfache Handwerke. Er trocknet Kräuter, nicht weil es nützlich ist, sondern weil der Duft ihn an ruhigere Tage erinnert. Er mag einfache Speisen, alte Lieder, das leise Knistern von Pergament. In seinen wenigen freien Momenten sitzt er gern irgendwo, wo das Licht schräg durch Äste fällt – und denkt an nichts. Oder an alles.
Der innere Widerspruch
Fenwyn kämpft gegen das Vergessen – aber er selbst ist das Vergessen. Er will andere schützen, ihre Geschichte bewahren – doch seine eigene ist ein Rätsel. Er hasst die Masken der Untoten, doch trägt selbst eine. Der Mann ohne Herkunft wird zum Hüter des Ursprungs. Dieser Widerspruch treibt ihn an – in jeder Begegnung, jedem Kampf, jeder stillen Nacht. Und manchmal fragt er sich:
Wenn er eines Tages weiß, wer er war – wird er dann noch derselbe sein?